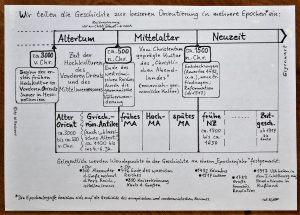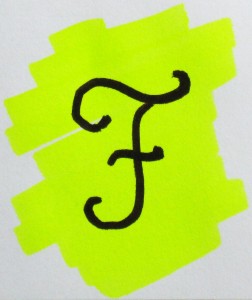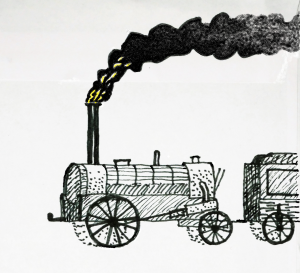——–Inhalt von „Clio“:
1. Einleitung
2a. Was ist „Geschichte“?
2b. Wozu „Geschichte“?
3. Philosophie und Geschichte
4. Apropos: „Fortschritt“ (Grußbotschaft des SR zum 100jährigen Gedenken des Ersten Weltkriegs)
5. Krise, Fortschritt, Vision
6. „Friede auf Erden“ – ein Wort zum Pazifismus / + Essay „Und den Menschen ein Wohlgefallen“
7. Rückschritt – ja, bitte: vom Orientierungs- zum Realitätsverlust
8. Lokal, regional, national, kontinental und global – oder: Das Allgemeine findet sich im Konkreten – und umgekehrt, an Beispielen: 8.1 Frechen und die Industrie
8.2 lokales Baudenkmal als Hinweis auf eine weltgeschichtliche Entwicklung: Bahnhof Belvedere in Köln-Müngersdorf
9. Beurteilung von historischen Persönlichkeiten und persönliche Urteile; dazu die Anlage: „Ist die Debatte um Carl Diem beendet?“
9.1 Geschichte und Deutungshoheit
9.2 Historische Persönlichkeiten als Leitfiguren der Gegenwart?
10. Demokratie – war und ist sie eine überschätzte Regierungsform?
11. Was macht ein(e) HistorikerIn?
.
1. Einleitung
 Clio oder Klio ist in der griechischen Mythologie eine der neun Musen, die die Inspiration des Kulturlebens versinnbildlichen. Die Muse Clio ist zuständig für den Bereich Geschichtsschreibung.
Clio oder Klio ist in der griechischen Mythologie eine der neun Musen, die die Inspiration des Kulturlebens versinnbildlichen. Die Muse Clio ist zuständig für den Bereich Geschichtsschreibung.
Hier sind aber nicht Teilbereiche oder Einzelbetrachtungen historischer Vorgänge und Ereignisse das Thema, vielmehr geht es auf „Clio“ um eine grundsätzliche Betrachtung und Reflexion von Geschichte an sich. Man könnte auch sagen: Schwerpunkt dieser (Unter-) Seite von fu-frechen.de ist eine geschichtsphilosophische Sicht. Darum geht diese Seite am Welttag der Philosophie online.
Eine geschichtsphilosophische Sicht – was bedeutet das konkret?
1. Geschichte als solche wird zum Thema gemacht, wir fragen nach dem Sinn von Geschichte und von „Geschichte“ als Wissenschaft sowie als Unterrichtsfach.
2. Wir wollen unsere Überlegungen nicht abgehoben-wissenschaftlich oder elitär-philosophisch formulieren, sondern – im Sinne des Bildungs-Anliegens der F.U.F. – möglichst allgemeinverständlich reden. Sprache dient schließlich in erster Linie der Kommunikation und weniger der Selbstdarstellung.
Wenn wir also über Geschichte reden wollen, müssen wir uns natürlich darüber klar sein, was wir unter „Geschichte“ genau verstehen..
2a. Was ist „Geschichte“?
„Geschichte“ wird in Schulbüchern meist von „Geschehen“ hergeleitet, also befasst sich das Fach „Geschichte“ mit dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Bevor nun die SchülerInnen über dieses Geschehen und über das Fach schlechthin diskutieren können, müssen sie erst einmal einiges Geschehen kennenlernen, es durch Epochenbegriffe gliedern und sich einen groben Überblick verschaffen. (Dazu gibt es einen Beitrag im >Blog: „Wie war das noch…“ Daraus zeigen wir hier die Übersichts-Grafik noch einmal:)
Dann erst lernen sie auch die Methoden kennen, mit denen HistorikerInnen ihre Informationen und Erkenntnisse aus und über vergangene Zeiten gewinnen. Da steht ganz obenan und im Zentrum der Forschung die Auswertung von Quellen. Unter einer „Quelle“ verstehen HistorikerInnen einen Text oder ein Bild oder ein Tondokument, aus dem die Vergangenheit zu uns spricht. Dazu gehören auch Gegenstände, z.B. Münzen. Diese Informationsquellen sollten möglichst nahe am Geschehen entstanden sein, damit wir möglichst aus erster Hand von Ereignissen und Vorgängen erfahren.
Zu beachten ist dabei, dass die untersuchten Quellen oft nicht neutral und nicht immer gut informiert berichten, sondern parteiisch einen bestimmten Standpunkt vertreten und/oder nur einen Teil des Geschehens wiedergeben können (oder wollen). Selbst bei großem Bemühen um „objektive“ Berichterstattung ist der zeitnah berichtende Mensch befangen in seiner Denk- und Sichtweise. Man muss also in der Quellenkritik Fragen berücksichtigen wie: Wer berichtet hier? Was kann er/sie zu jenem Zeitpunkt wissen? Welche Absichten verfolgt der/die VerfasserIn der Quelle? u.a.m. Nur so kann die Möglichkeit eingegrenzt werden, dass sehr subjektive oder tendenziöse Quellen oder sogar Propaganda als Tatsachenberichte fehlgedeutet werden.
Beispiel: Pharao Ramses II. ließ in einem Relief seine großen Erfolge in Stein meißeln, darunter seinen Sieg in der Schlacht von Kadesch über die Hethiter. Ein Tatsachenbericht in Bildern? Nein, nach Erkenntnissen der Forschung ging diese große Schlacht unentschieden aus, der Pharao „verkaufte“ sie seinen Untertanen trotzdem als Sieg. Das Relief muss also durch kritische Bewertung (= Quellenkritik) in seiner Aussage als Beschönigung, Lobhudelei, Propaganda gedeutet werden.
Hätten wir nicht Informationen aus anderen Quellen, dann könnten wir den Wahrheitsgehalt dieser Darstellung nicht überprüfen. Das zeigt: Wir brauchen möglichst viele Quellen, um zu einer einigermaßen zuverlässigen Bewertung zu kommen — ähnlich dem Kriminalisten, der möglichst viele Zeugenaussagen und dazu noch die Spurenlage am Tatort auswertet. Letzteres ist Aufgabengebiet der Archäologie. Die liefert dem Historiker wichtige zusätzliche Informationen und Hinweise. Besonders bei der Untersuchung lange zurückliegender Epochen stützen sich Historiker auf Erkenntnisse der Archäologie.
möglichst viele Zeugenaussagen und dazu noch die Spurenlage am Tatort auswertet. Letzteres ist Aufgabengebiet der Archäologie. Die liefert dem Historiker wichtige zusätzliche Informationen und Hinweise. Besonders bei der Untersuchung lange zurückliegender Epochen stützen sich Historiker auf Erkenntnisse der Archäologie.
Früher definierte die Geschichtswissenschaft ihr Arbeitsfeld Geschichte als die Zeit, in der schriftliche Zeugnisse, also Schriftquellen, hinterlassen wurden. Davor lag die Vorgeschichte (ohne schriftliche Quellen). Doch längst hat sich diese strenge Abgrenzung als unpraktisch erwiesen. Wieso sollte sich ein Historiker z.B. nicht mit den Kelten befassen, die keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterließen, aber sehr wohl eine hochentwickelte Kultur hatten, während die zeitgleich wirkenden Römer aufgrund ihrer hinterlassenen Papyrus-Schriftrollen und in Stein gemeißelten Inschriften Gegenstand intensiver historischer Forschung sind?
Natürlich muss man für eine Quellenkritik des „Gallischen Krieges“ von Julius Cäsar nicht nur römische Quellen der Zeit heranziehen, sondern auch versuchen, Cäsars Aussagen über seine keltischen Gegner durch andere Quellen und archäologische Erkenntnisse zu überprüfen. Diese Erkenntnisse erweiterten und erweitern sich im Laufe der Jahre durch neue Ausgrabungen. Dabei stößt man auf manche Irrtümer Cäsars und auch auf manche propagandistische Verfälschung, und selbstverständlich fragt man sich: Warum schrieb Cäsar überhaupt dieses Buch? Antwort: Er wollte sich dem römischen Senat und anderen gebildeten Römern als erfolgreicher Feldherr im Dienste des römischen Imperiums präsentieren — und damit seine weitere politische Karriere fördern.
Wir sehen schon: Geschichte ist eigentlich nicht der Bericht von vergangenem Geschehen, sondern oft nur der vorläufige Stand der Ermittlungen, der gegenwärtige Stand der Forschung. Wir müssen also der Genauigkeit halber sagen: Geschichte ist unsere Sicht der Vergangenheit auf der Grundlage des Forschungsstandes (ausführlicher in: W. Reinert, DIE BEATUS-CHRONIK, S. 93 ff.) Soweit die Definition für’s Erste.
2b. Wozu Geschichte?
Das „Was“ ist soweit geklärt, bleibt noch das „Warum“: Genauer: Wozu soll Geschichte gut sein, was bringt uns die Beschäftigung mit Vergangenem überhaupt? Genügt es nicht, im Hier und Jetzt zu leben und alles zu nehmen, wie es kommt?
Und außerdem ist sowieso Manchem die Geschichte in der Schule verleidet worden, weil der Lehrer unsympathisch war, weil die Lehrerin nur ihre Lieblingsthemen behandelt hat, weil man soviele Daten lernen sollte, oder weil man aus Schul-Unlust glaubte, man könnte „Nebenfächer“ auf der linken Pobacke absitzen und sich mit der Konzentration auf die „Hauptfächer“ über die Schulzeit bringen.
Wie uns „Geschichte“ bereichert, fand ich gut formuliert bei J. Rohlfes:
Historisch bewusst leben heißt: das Vergangene im Gegenwärtigen wahrnehmen. Damit verbindet sich die Einsicht, dass fast alle uns derzeit beschäftigenden Phänomene und Probleme eine historische Herkunft haben, die nur der Naive für belanglos hält. (Umrisse einer Didaktik der Geschichte. 3. 1973, S. 138)
Die Dinge auch in ihrer historischen Dimension erfassen bedeutet meist, ein tieferes Verständnis zu entwickeln und frühere Erfahrungen mit einem Problem nutzbar zu machen. Das bedeutet ferner, den Blick zu schärfen für Entwicklungsprozesse: Die Dinge oder Zustände sind nicht fertig vom Himmel gefallen, sondern haben eine Entwicklung durchlaufen, die man vielleicht schon frühzeitig heraufziehen sah oder hätte sehen können.
Die Dinge in ihrer historischen Dimension wahrzunehmen schärft oft auch den Sinn für eine multiperspektivische Betrachtung: Man versucht, sich bei der Betrachtung einer historischen Situation in verschiedene Parteien hineinzuversetzen und deren Standpunkte bzw. deren Gründe für ihre Haltung und ihr Handeln zu verstehen, ihre Interessen zu erkennen. Mit dieser Sicht kann man evtl. kreative Lösungsvorschläge zu einem ähnlichen, aktuellen Problem entwickeln und auf den Tisch bringen, ohne dabei gleich einen Teil der Betroffenen vor den Kopf zu stoßen und in Abwehrhaltung zu versetzen. Im günstigen Fall gelingt dann ein Interessenausgleich, eine friedliche Entschärfung oder gar Bereinigung eines Konflikts. Das gilt nicht nur für’s Politische, das kann auch im Geschäfts- und Privatleben weiterhelfen.
3. Philosophie und Geschichte
Was ist nun der Gegenstand der Betrachtung von Philosophie in Bezug auf Geschichte? Es geht nicht allein um die Frage, ob eine Befassung mit Geschichte Sinn macht, sondern auch, welcher Sinn hinter der Geschichte steht, und ob und wie wir diesen Sinn erkennen  können.
können.
Das sind zweifellos philosophische Fragen, denn sie nehmen das Ganze in den Blick, nicht die Fragen nur einer einzelnen Wissenschaft. Warum wir uns mit Geschichte befassen (sollten), wird kurz und übersichtlich schon in dem Buch DIE BEATUS-CHRONIK (S. 98) erklärt. Wir werden dadurch auch zum Nachdenken über uns selbst angeregt (Woher kommen wir, wohin gehen wir?) und darüber hinaus zu der Frage: Hat die ganze Geschichte der Menschheit, ja der Welt, überhaupt einen Sinn, und wenn ja, welchen?
Diese Sinnfrage hat natürlich schon viele Menschen vor uns beschäftigt. Im Christentum orientierte man sich dabei an der Bibel, die nicht von Geschichte in unserem heutigen Sinne spricht, sondern von Heilsgeschichte. Soll heißen: Gott hat die Welt nicht nur geschaffen, er bestimmt auch ihr Ende. Die Heilsgeschichte ist auf ihr Ziel gerichtet, das Weltende mit dem Weltgericht. Bis dahin durchläuft sie mehrere Epochen, nämlich die Zeit des Alten Testaments, die des Neuen, und die Zeit danach bis zur Wiederkehr des Jesus Christus als Weltenrichter  (vgl. ebda., S. 10).
(vgl. ebda., S. 10).
Diese Heilsgeschichte kennt keine historische Entwicklung in unserem heutigen, wissenschaftlichen Verständnis. So sah z.B. Martin Luther (im frühen 16. Jahrhundert) noch ein „irdisches Jammertal“ ohne Entwicklung bis zum Jüngsten Gericht. Die heute vorherrschende Sicht ist eine säkulare, die Gottes Wirken oder Eingreifen (da nach wissenschaftlichem Verständnis nicht beweisbar) unberücksichtigt lässt und die Geschichte als Menschheitsgeschichte sieht, in der man nachvollziehbare Regeln oder Gesetzmäßigkeiten zu finden sucht, nach denen sich diese Entwicklung vollzieht.
Eine dieser Gesetzmäßigkeiten fußt auf dem Fortschrittsgedanken. Diesen erbte die moderne Geschichtswissenschaft vom 19. Jahrhundert, in dem sie selbst entstand. Angesichts der Entwicklung der menschlichen Zivilisation, insbesondere der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, griff die Vorstellung vom Fortschritt in der Geschichte im 19. Jahrhundert in Europa um sich. Man glaubte, dass eine allgemeine Höherentwicklung auf allen Gebieten der Zivilisation stattfinde, und dass Europa an der Spitze dieser Entwicklung stehe.
Das marxistische Modell, das im selben Jahrhundert entstand, sah in der Menschheitsgeschichte eine Abfolge von Klassenkämpfen bis hin zum Kapitalismus, der abgelöst werde durch eine Phase des Sozialismus, die zum Kommunismus als höchstem Ziel der Geschichte hinführe. Der kommunistische Endzustand werde keine Klassenkämpfe mehr kennen, da alle Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen könnten und die Klassenunterschiede beseitigt seien. (Manche Kritiker meinen: Dieses Modell zielt wie die christliche Heilsgeschichte auf einen Endzustand.)
Inzwischen sind Staaten, in denen kommunistische Bewegungen die Macht übernahmen, nicht in der Lage gewesen, eine überzeugende Alternative zu anderen Systemen aufzubauen, d.h. eine menschlichere Gesellschaft mit einer stabilen Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Der „Ostblock“ ist von der politischen Landkarte verschwunden, China auf dem Weg in eine teilkapitalistische Ordnung, Nordkorea ein Macht(anbetungs)apparat mit einer zeitweise hungernden Bevölkerung, und Kuba (auch durch den fortwährenden Boykott der nahen USA) wirtschaftlich kaum lebensfähig.
Bisher haben Staaten, in denen eine gesellschaftliche Utopie zur bestimmenden Ideologie erhoben wurde, keine bleibenden Nachweise der Realisierung ihrer Ziele vorgelegt. Machteliten wurden gestürzt, aber neue bildeten sich, die auch wiederum meist ihre privilegierte Stellung zum persönlichen Vorteil nutzten und Kritik unterdrückten (aktuelle Beispiele: China, Venezuela). Das betrifft nicht nur säkulare Ideologien, sondern auch religiöse, also die von Gottesstaaten: Der Iran ist ein Beispiel dafür, wie die neuen Machteliten ein Land ausplündern, dessen Reichtum hätte gerechter verteilt werden können.
Man kann sich, mit Blick auf viele Länder, in denen die Bevölkerung in Umstürzen große Opfer brachte, stirnrunzelnd fragen, ob es sich für ebendiese Bevölkerung gelohnt hat, oder ob unterm Strich nur andere Eliten an die Macht kamen und sich daran klammerten. Die eigentliche Frage ist, ob es weiterhin Ausbeutung und Unterdrückung gab, oder doch ein besseres Leben für die große Mehrheit… Oder reicht es, sich damit zu trösten, dass nach der Revolution die eigene Partei oder die eigene Religion den Staat beherrscht? In manchen Staaten haben die Revolutionäre, an der Macht etabliert, die Probleme des Landes auch nicht unter Kontrolle bekommen und das Volk mit Parolen und Meinungsmanipulation ruhig zu stellen versucht.
Wie unsere Zeit später, sagen wir: in 50 oder hundert Jahren von HistorikerInnen gesehen und bewertet werden wird, lässt sich schwer voraussagen. Die sogenannte Globalisierung hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, sie weist auch die politischen Machteliten in ihre Schranken, sofern diese nicht zugleich auch wirtschaftliche Macht besitzen, d.h. Einfluss auf die globalen Geldströme nehmen können. Vielleicht wird man daher unsere Zeit später als die Machtübernahme des Großen Geldes sehen, die Epoche der GGG (globalisierte Geldgier).
Vielleicht steht uns aber auch noch ein großer Crash bevor, indem dieses System, wenn es unreguliert wuchert, an sich selbst erstickt. Wer weiß? Es liegen uns nach meiner Kenntnis keine Denkmodelle vor, die uns den tieferen Sinn hinter diesen Vorgängen in einem Deutungszusammenhang erklärten, der nicht auf religiösen Grundannahmen fußte. Dabei scheint es dem menschlichen Geist keine Ruhe zu lassen, einen Sinn hinter alldem zu suchen und die Geschichte in diesem Sinne zu deuten. In früheren Jahrhunderten war man gewohnt, im Zweifel hinter allen unerklärlichen Ereignissen Gottes Fügung zu sehen. Dann kamen, wie oben erwähnt, säkulare Geschichtsdeutungen auf.
Dahinter steht immer der Wunsch, Geschichte habe einen Sinn und eine (vielleicht dem ersten Blick verborgene) Entwicklung. Schon die Einteilung der Geschichte in Epochen ist ein Deutungsversuch. Selbst Anfang der 1990er Jahre deuteten Viele den Zusammenbruch des Ostblocks als Beginn einer friedlichen Ära, gar einer ersehnten Welt-Friedens-Endzeit, sozusagen eine säkulare Erlösung der Menschheit von menschengemachten Plagen. Inzwischen sehen Alle, dass diese Erlösung ausblieb.
Vielleicht erübrigt sich die Sinnsuche aber auch demnächst, sollte aus den Tiefen des Alls ein großer Brocken auf unseren Planeten zufliegen, den wir nicht davon abhalten können, die Erde zu treffen. Dann ginge es uns wie den Dinosaurieren, die einst die Erde beherrschten, aber durch einen gewaltigen Kometeneinschlag und seine Folgen ausgelöscht wurden. Das wäre auch für uns das Ende der Geschichte. So gesehen, sollten wir nichts für garantiert und selbstverständlich halten.
Der Sinn der Geschichte könnte darin liegen, dass wir versuchen, ihr eine positive Richtung zu geben: positiv im Sinne einer humanen, d.h. zugleich vernünftigen und menschlich mitfühlenden Ordnung. Dazu müssten aber mehr Menschen bereit sein, gewohnte Egoismen zu überwinden und die Vorteile einer ausgleichenden, Konflikte entschärfenden, multilateral vereinbarten Ordnung zu erkennen und zu schätzen.
S. R.
.
4. Apropos: „Fortschritt“
Grußbotschaft des SR zum 100jährigen Gedenken des Ersten Weltkriegs
.
Wer ein wenig länger darüber nachdenkt, dem stellt sich der Begriff „Fortschritt“ als ein problematischer dar. Denn dieser Begriff ist außerordentlich wertungsschwanger: Es hängt ganz vom Weltbild und den Wertvorstellungen des Betrachters ab, was er als Fortschritt bezeichnet und was nicht. Und daher gilt auch für die Geschichte: Was als „historischer Fortschritt“ gilt, ist eine Frage der Bewertung aufgrund vorgefasster Ansichten.
vom Weltbild und den Wertvorstellungen des Betrachters ab, was er als Fortschritt bezeichnet und was nicht. Und daher gilt auch für die Geschichte: Was als „historischer Fortschritt“ gilt, ist eine Frage der Bewertung aufgrund vorgefasster Ansichten.
Es bedarf eines „Zivilisationsbruches“, um solche Bewertungen ins Wanken zu bringen. So wurde der vorherrschende, optimistische Fortschrittsglaube am Ende des „langen 19. Jahrhunderts“ durch den  Untergang der angeblich unsinkbaren „Titanic“ 1912 schon ein wenig angekratzt, aber erst nachhaltig ins Wanken gebracht durch die Katastrophe des Ersten Weltkriegs (1914-18) mit seinem nie zuvor gekannten Massenschlachten, als der waffentechnische Fortschritt, der zuvor Europas Großmächte zu Kolonial- und Weltmächten werden ließ, sich nun in Europa selbst verheerend auswirkte.
Untergang der angeblich unsinkbaren „Titanic“ 1912 schon ein wenig angekratzt, aber erst nachhaltig ins Wanken gebracht durch die Katastrophe des Ersten Weltkriegs (1914-18) mit seinem nie zuvor gekannten Massenschlachten, als der waffentechnische Fortschritt, der zuvor Europas Großmächte zu Kolonial- und Weltmächten werden ließ, sich nun in Europa selbst verheerend auswirkte.
Sicher, es gab auch dann noch, gerade hierzulande, etliche Unbelehrbare, geprägt von einem militaristischen Männlichkeitskult, die von „Stahlgewittern“  in den Schützengräben bramarbasierten und den immensen Kriegsschäden einen angeblichen moralischen Gewinn gegenüberstellten. Die dann gern die „Dolchstoßlegende“ aufgriffen, somit Ursache und Wirkung der Kriegsniederlage vertauschten, und später Hitlers Revanche-Parolen zujubelten. Diese „Männlichkeit“ war Starrsinn anstelle von Einsicht: Leid sollte mit noch mehr Leid „geheilt“ werden — ein Unsinn mit fatalen Folgen.
in den Schützengräben bramarbasierten und den immensen Kriegsschäden einen angeblichen moralischen Gewinn gegenüberstellten. Die dann gern die „Dolchstoßlegende“ aufgriffen, somit Ursache und Wirkung der Kriegsniederlage vertauschten, und später Hitlers Revanche-Parolen zujubelten. Diese „Männlichkeit“ war Starrsinn anstelle von Einsicht: Leid sollte mit noch mehr Leid „geheilt“ werden — ein Unsinn mit fatalen Folgen.
Anderen gab der Zivilisationsbruch des Ersten Weltkriegs zu denken, und sie hofften auf Einsicht und z.B. den Impuls zur Völkerverständigung, den die Einrichtung des Völkerbundes mit Sitz in Genf versprach. In Deutschland blieb die Parole „Nie wieder Krieg“ leider die Maxime einer Minderheit. Ein Großteil der Bevölkerung sah Deutschland durch den Versailler „Diktatfrieden“ hart und ungerecht behandelt und gedemütigt. Das war bekanntlich der Nährboden, auf dem rechtskonservative, chauvinistische und revanchistische Kräfte wuchsen, denen sich Hitler als Führer andiente.
Mit der totalen Niederlage im Zweiten Weltkrieg, so könnte man meinen, sei endlich in allen Köpfen die Einsicht durchgebrochen, dass Deutschland auf einen falschen Weg geführt worden war. Aber selbst danach gab es noch einen braunen Bodensatz in Nachkriegs(West-)deutschland, der die demokratische Ordnung ablehnte und meinte, sie sei abzulehnen, weil von den Siegermächten aufgezwungen. Immer noch spukte das Versailles-Syndrom in diesen Köpfen, die einfach nicht fähig zum Umdenken waren, die an überalterten Denkschemata festhielten und sich nicht an humanen Grundprinzipien (Menschenrechte) orientieren wollten.
Was heißt das im Hinblick auf den Begriff „Fortschritt“? Zunächst einmal: Wenn man eine Entwicklung hin zu einer humaneren Staats- und auch Weltordnung als Fortschritt sieht (darauf müsste man sich schon einigen), dann hat das 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen bei vielen Menschen durch schmerzliche Erfahrungen einen Lernprozess in Gang gesetzt, wenn nicht sogar frühere Annahmen bestätigt, die in zwei Grundforderungen münden:
-
- Krieg darf keine Option der Politik sein.
- Eine gerechtere Ordnung des Interessen-Ausgleichs entschärft oder vermeidet Konflikte, die zu Spannungen und Kriegen bzw. Bürgerkriegen führen könnten.
Wie wir alle wissen, haben wir auf diesem Weg des humanitären Fortschritts bis heute nur(?) Teilerfolge erzielt. Für manche Gegenden der Welt sieht es derzeit düster aus, sie machen gerade schmerzhafte Erfahrungen, die wir in Europa hinter uns haben. Ob sie wenigstens aus ihren eigenen Erfahrungen lernen? Oben wurde ja schon erwähnt, dass es selbst in Deutschland lernresistente Menschen gibt, die, statt sich ihres Verstandes zu bedienen, lieber dumpfen Gefühlswallungen folgen und die einfachsten Parolen für die besten halten (zu besichtigen z.B. bei Neonazi-Aufmärschen).
Leider hängt der Fortschritt nicht nur von der Einsicht einzelner Personen ab, sondern auch von der Entwicklung politischer und wirtschaftlicher Machtverhältnisse. Wo machtpolitische und wirtschaftsimperialistische Interessen durchgesetzt werden, da werden immer wieder Minderheiten und ganze Völker Opfer von Gier und Egoismus. Zwar wurden nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs die Vereinten Nationen (UNO) eingerichtet, aber auch im Sicherheitsrat der UNO werden Machtspiele gespielt, sodass oft Hilfe für Menschen in Krisengebieten verzögert oder blockiert wird.
Was bleibt zu tun? Um den humanitären Fortschritt zu unterstützen, müssen die vielen betroffenen Menschen zu verhindern suchen, dass sich zuviel Macht in den Händen Weniger konzentriert, weil Macht leicht dazu verführt, sie zu persönlichen oder gruppenegoistischen Zwecken einzusetzen. Diese Gefahr wurde schon in der ersten Demokratie der Geschichte im antiken Athen erkannt, und man suchte ihr mit dem Scherbengericht zu begegnen, das zu mächtig gewordene Politiker für zehn Jahre verbannen konnte.
Machtkonzentration verführt auch dazu, schwächere Kräfte unterzubuttern, z.B. Minderheiten in einem Staat zu unterdrücken, ihnen die politische Mitsprache zu verwehren, ihre Sprache offiziell (in Medien, staatlichen Behörden und Schulunterricht) zu verbieten, ihnen die kulturelle Identität zu rauben. Stalin ging sogar so weit, im Vielvölkerstaat Sowjetunion durch Zwangsumsiedlungen ganze Völker zu zerstreuen. So erging es u.a. den Krimtataren; die später Zurückgekehrten wurden durch Zuzug vieler Russen zur Minderheit auf der Krim. Daraus leitete Putin im Februar 2014 den Anspruch ab, die Krim sei russisch – und habe schon Jahrhunderte zu Russland gehört – und sprach am 18. März 2014 bei der Annexion der zur Ukraine gehörenden Krim sogar von einer „Wiedervereinigung“.
Ein solches Vorgehen und solche vorgeschobenen Rechtfertigungen sind uralt und kein historischer Fortschritt, sondern ein Rückfall in eigentlich überholte Muster von Großmachtpolitik. Selbst wenn ein Großteil der russischen Bevölkerung Putins Muskelspielen und seinem Auftreten als „starker Mann“ Beifall spendet: Das hat mit Demokratie oder Politik zum Wohle Aller nichts zu tun, und nur Menschen, die in einem Land ohne demokratische Erfahrung oder Tradition leben, die quasi nur gute und schlechte Zaren kennen, können sich über so einen „starken Mann“ an der Spitze freuen – und beten, dass er sich als guter Zar erweisen möge.
Nun ist eine Staats- oder Regierungsform kein absoluter Wert an sich, denn die entscheidende Frage der Bewertung, die oben schon gestellt wurde, muss natürlich lauten: Was bringt diese für die Menschen in diesem Staat? Schafft sie Ausgleich, oder nutzt sie Macht, um einen Teil der Bevölkerung auf Kosten eines anderen zu bevorzugen? Es dürfte klar sein, dass eine moralische Bewertung sich allein an diesem Kriterium orientiert. Diesem Kriterium muss sich selbst ein demokratisch verfasster Staat stellen: Es reicht nicht zu sagen, wir haben eine Demokratie, und daher sind wir automatisch ein guter Staat und ein guter Partner in den internationalen Beziehungen.
Eine funktionierende Demokratie erfordert nämlich auch wache Demokraten, die den Beauftragten (Abgeordneten und Regierenden) auf die Finger sehen, und überhaupt eine wache Öffentlichkeit, die sich dessen bewusst ist, dass man sich nach Wahlen nicht zurücklehnen und die Beauftragten einfach machen lassen kann. Fortschritt misst sich daran, in welchem Maße Demokratie verwirklicht ist, und wie frei in einem öffentlichen Diskurs über die richtige Politik debattiert wird. Das ist ein wichtiges Merkmal einer lebendigen Demokratie, die nicht nur auf dem Papier steht. (mehr siehe unten >10.)
Was moderne Menschen unter Fortschritt verstehen sollten, ist damit hinreichend geklärt. Eingangs stellten wir fest, dass Viele unter „Fortschritt“ verschiedene Dinge verstehen, allgemein  gesprochen könnte man sagen: Jeder versteht darunter eine Entwicklung, die auf dem Weg zu einem von ihm ins Auge gefassten Ziel ein Stück weiter führt. In der Geschichte heißt das: Je nach dem, welchem Geschichtsmodell ich anhänge, sehe ich ein Ereignis oder eine Entwicklung als Fortschritt oder auch als Rückschritt an.
gesprochen könnte man sagen: Jeder versteht darunter eine Entwicklung, die auf dem Weg zu einem von ihm ins Auge gefassten Ziel ein Stück weiter führt. In der Geschichte heißt das: Je nach dem, welchem Geschichtsmodell ich anhänge, sehe ich ein Ereignis oder eine Entwicklung als Fortschritt oder auch als Rückschritt an.
Beispiel: Für Kommunisten hat es um 1990 mit der Auflösung des Ostblocks und dem sogenannten Sieg des Kapitalismus einen historischen Rückschritt gegeben, während Anhänger eines demokratischen Sozialismus sagen, einen echten Sozialismus habe es ja gar nicht gegeben (obwohl die DDR-Oberen in der Spätphase dauernd vom „real existierenden Sozialismus“ sprachen), und um den Kommunismus mit stalinistischen Zügen sei es nicht schade. Im übrigen dürfen Vertreter verschiedener Spielarten des Marxismus weiter über Ziel und Wege dorthin streiten.
Das oft bemühte „Rad der Geschichte“ dreht sich weiter, und für Manche ist es schlicht nur das Rad des Schicksals, oder des Glücks, das eine Mischung aus Fortschritt und Rückschlägen bereithält, dessen Lauf man aber nicht aufhalten könne. Doch unser Hirn neigt nun mal dazu, einzelne Beobachtungen und Fakten irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen und in ein System einzuordnen. Und daher waren und sind viele Denker darum bemüht, doch hinter der Geschichte einen Sinn zu entdecken.
Da erhebt sich die Frage: Sind wir überhaupt in der Lage, in oder hinter der Geschichte Prinzipien und Regeln zu erkennen? Und wenn ja, was tun wir daraufhin? Hegel äußerte dazu eher resignierend: „Die Geschichte hat noch nie etwas anderes gelehrt, als dass die Menschen nichts aus ihr gelernt haben.“ Und im Hinblick auf „Fortschritt“ äußerte der Dichter Robert Musil ebenso treffend wie sarkastisch: „Wir irren vorwärts.“
Paradoxerweise spornen uns aber solche Erkenntnisse erst recht dazu an, uns mit Geschichte zu beschäftigen. Denn wir denken: Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein — wir können, ja müssen doch aus den Erfahrungen der Menschheit lernen! Schon Cicero sprach von der Geschichte als Lehrmeisterin. Dann, hoffentlich, brauchen wir nicht ständig das Rad neu zu erfinden, oder immer wieder unter denselben Fehlern zu leiden.
Und vielleicht können wir die Welt sogar ein Stück weit verbessern – zum Wohle aller Menschen. Also: positiv denken! —
S.R., 01.01.2014, aktualisiert 31.03.2014
.
5. Krise, Fortschritt, Vision
„Da haben wir’s mal wieder!“ rief ich kopfschüttelnd vor dem Fernseher, als Auszüge von Putins Rede anlässlich der aktuellen Entwicklung der Krise in der Ukraine und der Annexion der Krim durch Russland gesendet wurden. Da wurde die Geschichte bemüht und als Argumentations-Steinbruch benutzt: Man pickt sich heraus, was einem in den Kram passt, und ignoriert, was nicht passt.
Man pickt sich heraus, was einem in den Kram passt, und ignoriert, was nicht passt.
Wir Deutsche, sagte Russlands Präsident Putin, müssten doch Verständnis haben für diese „Wiedervereinigung“ der Krim mit Russland. (Er meinte damit 1990, nicht 1938.) Wo geltendes Völkerrecht die bestehenden Staatsgrenzen schützt, schieben Machtpolitiker gern vor, notleidenden oder drangsalierten „Landsleuten“ helfen zu müssen, indem man sie, nein, das Territorium, in dem sie leben, „heim ins Reich“ holt. Die Krim, egal wieviele Russischsprechende dort leben, ist völkerrechtlich Teil der Ukraine – egal, wie lange schon, und egal, wie lange sie vorher zum russischen Staatsgebiet gehörte.
Nach der Heim-ins-Reich-Logik jedoch müssten die Krim-Tataren Russen und Ukrainer von der Halbinsel werfen und sich „ihr“ Land zurückholen; d.h. die von Stalin brutal nach Sibirien deportierten Tataren müssten alle auf die Krim zurücksiedeln. Und die Türkei könnte Anspruch erheben, weil die Krim lange Teil des Osmanischen Reiches war. Und so kann es weitergehen: Wer hat noch nicht, wer will nochmal historisch begründete Ansprüche erheben? Bitte hinten anstellen!
Die deutschsprachige Bevölkerung in Ostbelgien, im Versailler „Diktatfrieden“ 1919 von Deutschland abgetrennt, müsste nach der Heim-ins-Reich-Logik ja nichts sehnlicher wünschen, als von Deutschland annektiert zu werden. Tut sie aber nicht! Im Gegenteil, im spaltungsbedrohten Belgien, wo die Flamen aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Staatsverband ausscheren wollen, sind die ehemaligen Deutschen im Osten Belgiens sogar die besten Belgier überhaupt: Sie sehen keinen Sinn darin, den Staat zerbrechen zu lassen, und sie kommen als Minderheit in Belgien ganz gut zurecht.
Fragt man sich, warum denn die Ostbelgier sich nach Anschluss an Deutschland sehnen sollten, dann kommt man als vernünftiger Mensch ins Grübeln — es sei denn, man ist gedankenlos nationalistisch und chauvinistisch und meint, am deutschen Wesen müsse die Welt genesen, und Alle strebten selbstverständlich das höchste irdische Glück an, nämlich: zu Deutschlands Bevölkerung zu zählen. Solcher Sichtweise liegt aber eine Vermischung von Dingen zugrunde, die man trennen kann: Heimat, wo man aufgewachsen ist und sich zu Hause fühlt, ist ein emotionales Gut. Der Nationalstaat dagegen ist ein politisches Konstrukt, und nicht identisch mit Heimat. Denn letztere ist vor allem regional bestimmt und fragt nicht nach weiter gefassten Staatsgrenzen.
Die Ostbelgier, als Gebiet Eupen-Malmedy nach dem Ersten Weltkrieg zu Belgien geschlagen, haben keineswegs ihre Heimat verloren. Sie wurden nicht vertrieben, sie bekamen nur eine andere Staatszugehörigkeit. Und nachdem sie auch ihre deutsche Sprache wieder offiziell gebrauchen durften, fehlte ihnen eigentlich nichts — zumal Belgien von Anfang an mit Nachbar Deutschland in der EWG, später EU, sowie in der Nato Mitglied war.
Mal ehrlich: Wozu sind Staaten eigentlich da? Und was genau ist eine Nation? Wenn man mal alle emotionalen Momente, die pseudoreligösen Glaubensvorstellungen und allen Hurra-Patriotismus beiseite lässt, dann kann man erst wirklich darüber nachdenken.
Zunächst einmal: Die „Nation“ als Begriff ist historisch ein Kampfbegriff der Französischen Revolution von 1789, und unter der Losung „liberté, égalité, fraternité“ betonte man damals die Gleichheit aller Franzosen — im Gegensatz zu der Ständegesellschaft mit ihrer schroffen Ungleichheit und dem absolutistisch regierenden König an der Spitze. Die „Nation“ wurde also als innenpolitisch neue Konzeption verstanden, der Begriff richtete sich gegen ein veraltetes Herrschafts- und Gesellschaftsystem — und keineswegs gegen andere Nationen (die es im modernen Sinne auch noch nicht gab). Erst die Intervention ausländischer Truppen, die das alte Herrschaftssystem (das Ancien Régime) in Frankreich retten sollte, löste als Gegenbewegung den Krieg Frankreichs gegen europäische Staaten aus, der dann die Revolution auch in andere Länder exportieren sollte.
Daraus machte Napoleon bekanntlich einen Eroberungskrieg, der wiederum bei anderen Völkern antifranzösische Gefühle entstehen ließ; zugleich wollten diese aber auch die Errungenschaften der Französischen Revolution gewinnen oder behalten. So gab es in Deutschland zwar aufkommenden Nationalismus, der ein geeintes Deutschland wollte, zugleich aber auch die Forderung nach Abschaffung der vielen Fürstentümer mit absolutistischer Herrschaft, und die Gewährung bürgerlicher Freiheiten wie in Frankreich. In Deutschland und einigen anderen Ländern verband sich also die Idee der geeinten Nation mit Bürgerfreiheit. Somit war in dieser historischen Situation Nationalismus eine fortschrittliche politische Idee.
Später änderte sich das: Nachdem 1849 die Revolution in Deutschland wie in Österreich-Ungarn niedergeschlagen worden war und freiheitlich gesinnte Menschen verfolgt wurden, band man die Idee des Nationalstaates zunehmend an das Streben nach einem deutschen Kaisertum in einem konservativ geprägten Deutschland. Das wurde 1871 auch etabliert, der preußische König zugleich deutscher Kaiser. Nun war Nationalismus staatstragend und eher antidemokratisch. Er war auch antisozialistisch, denn Sozialisten und Sozialdemokraten waren international orientiert.
Da wir im Jahr 2014 an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnern, sei auch erwähnt, dass sich damals fast alle Deutschen, auch die Mehrheit der Sozialdemokraten, dazu hinreißen ließen, dem Ruf unter die nationale Fahne zu folgen und die internationale Solidarität der Arbeiterklasse wie auch die allgemeine menschliche Solidarität hintanzustellen. In den kriegführenden Staaten ließen sich die Menschen großenteils freiwillig für das „Vaterland“ einspannen: Wir sind die „Guten“, die Menschen feindlicher Staaten die „Bösen“. Klingt das kindisch? Aha… dann sollte das zu denken geben!
Auf den Schlachtfeldern geschahen ab August 1914 Dinge, die sich kaum jemand in seinen schlimmsten Albträumen vorgestellt hatte. Menschen wurden zu Menschenmaterial, verheizt in einem Krieg, dessen Sinn — mal die Ehrenpusselei und Vaterlandsrhetorik beiseitegelassen — niemand plausibel darlegen konnte. Klar, es wurden am Kartentisch Kriegsziele gesteckt: Es ging den Strategen um Verschiebung von Staatsgrenzen, um Veränderung der Machtverhältnisse zwischen den europäischen Staaten, um Hegemonialträume. Aber was sollten die gewinnen, die Leib und Leben dafür einsetzten, die „verheizt“ wurden?
Wer gewinnt denn in einer solchen Gewaltorgie, die man „Krieg“ nennt? Selbst die Siegermächte des Ersten Weltkrieges schauten fassungslos auf die Opfer und Schäden — und schraubten ihre Reparationsforderungen an die Unterlegenen entsprechend in die Höhe. Zur Rechtfertigung der Härte gegen die Verlierer erklärten die Sieger die „Bösen“, insbesondere das Deutsche Reich, zu den allein Schuldigen am Ausbruch des Krieges. Bei den Siegern herrschten Rachegedanken über politische Weitsicht.
Das wiederum rächte sich: Als sie endlich die Härten des Versailler Vertrages zu mildern bereit waren, kam das schon den falschen Kräften in Deutschland zugute, nämlich den Revanchisten und den Strategen des nächsten Krieges: Mit der Demütigung Deutschlands hatte man Hitler die Plattform zum Aufstieg geschaffen, die dieser in der Wirtschaftskrise konsequent nutzen konnte.
Deutsche wie Franzosen, Briten u.a. hatten starke emotionale Bindungen an Begriffe wie „Nation“ und „Vaterland“ entwickelt. Auf dieser Tastatur spielte auch Hitler und führte Deutschland in den Zweiten Weltkrieg. Selbst Graf Stauffenberg, der führende Hitler-Attentäter des 20. Juli 1944, stieß vor seiner Exekution als Letzte Worte den Ruf aus: „Es lebe das heilige Deutschland!“ Es ging ihm also darum, Deutschland vor einem zerstörerischen Hitler zu retten. Es lag ihm wie Anderen fern, die Nation als Wertbegriff in Frage zu stellen.
Und doch muss diese Frage nach alldem gestellt werden. Während die Welt noch in Kategorien dachte, in denen der Nationalstaat, ein Ideal des 19., auch im 20. Jahrhundert einen hohen politischen Stellenwert hatte, entwickelten sich die Blöcke des Kalten Krieges als Teilung der Welt. In Deutschland empfand man die Block-Grenze als besonders schmerzlich, spaltete sie doch die Nation politisch und ideologisch. Die Wiedervereinigung wurde 1949 als Staatsziel in die Präambel des Grundgesetzes geschrieben, auch die DDR verwies in ihrer ersten Verfassung auf die Einheit der Nation.
Als Deutschland 1990 wiedervereinigt wurde, war der Jubel groß, da ja die innerdeutsche Grenze nicht nur eine Nation gespalten, sondern konkret auch Menschen getrennt und Familien zerrissen hatte. Doch so schnell wuchs nicht zusammen, was zusammmengehörte (nach einem Spruch von Willy Brandt). In Westdeutschland, dem „kapitalistischen Westen“ zugehörig, fürchteten Viele, sie müssten von ihrem Wohlstand an die „armen Brüder und Schwestern im Osten“ etwas abgeben. Da war mehr egoistische Besitzstandswahrung als nationale Solidarität in den Köpfen und Herzen. Nation? Ja, aber…
Über diese Haltung wurde viel Kritik und Empörung geäußert. Aber hier zeigte sich auch der wahre Wert des Begriffs „Nation“: Er taugt in erster Linie dazu, die eine gegenüber anderen Nationen abzugrenzen, aber er verbindet nicht die Menschen innerhalb des Landes automatisch zu einer Solidargemeinschaft. Wer sagte denn schon in den 1990er Jahren: „Du bist auch ein Deutscher, also gebe ich Dir etwas ab, und ich zahle auch gern den Solidaritätsbeitrag auf meine Steuern, damit ich Ostdeutschland aufhelfen kann.“ Im Westen wurde viel lieber gemeckert.
Solidaritätsbeitrag auf meine Steuern, damit ich Ostdeutschland aufhelfen kann.“ Im Westen wurde viel lieber gemeckert.
Was also bedeutet uns heute der Begriff „Nation“? In der Nachkriegszeit waren wir in Westdeutschland bereit, uns in Europa zu integrieren, weil die Nazis die deutsche Nation mit Ihrem „Blut-und-Boden“-Gesabbel überstrapaziert und Nationalismus desavouiert hatten. Folge: Von Deutschtümelei wollten die meisten Leute nichts mehr hören. Stattdessen verbanden die Westdeutschen ihr „Wirtschaftswunder“ mit Westorientierung und politischer West-Integration. Andere Nationen teilten aber unsere Erfahrung nicht und meinten weiterhin, Nationalgefühl und Nationalstolz seien positiver Bestandteil eines gemeinsamen, einigenden nationalen Erbes.
So galten die (West-)Deutschen als die eifrigsten „Europäer“ in der EU. In anderen EU-Ländern hingegen propagierten einige Politiker ein „Europa der Vaterländer“. Das sollte heißen: Wir wollen keine Kompetenzen und Rechte an europäische Zentral-Instanzen abgeben, sondern unabhängige Nationalstaaten bleiben. Damit hätte man die Entwicklung zur europäischen Einigung praktisch auf der Stelle treten lassen bzw. verhindert.
Rational betrachtet muss Europa seine Bedeutung in der Welt durch mehr Geschlossenheit erhalten. Nationalegoistische Querschüsse schwächen die EU. Doch wider besseres Wissen schüren einige Politiker immer noch nationale Gefühle und machen die EU schlecht (wobei sie die Vorteile der EU-Zugehörigkeit verschweigen), um auf emotionalen Wellen zu surfen und Wählerstimmen zu sammeln.
Das lässt sich leider in vielen Ländern der EU beobachten – nicht nur 2013/14 in Großbritannien, wo Premierminister Cameron einen anti-europäischen Kurs steuerte und sich damit im Amt zu halten versuchte. (Ironie der Geschichte: Viele Schotten streben nach Loslösung aus Großbritannien, Schottland soll als eigener Nationalstaat aber weiterhin der EU angehören.) Jahre später haben britische Politiker nach einem erbärmlichen Gezänk den „Brexit“ herbeigeführt — entgegen dem Willen vor allem jüngerer Briten, und entgegen den Warnungen aus der Wirtschaft. Der nationale Eigensinn schießt hier ein Eigentor zum Schaden des ganzen Landes.
Noch einmal: Was bringt den Menschen die „Nation“ bzw. der Nationalstaat? Ist der Appell an nationale Gefühle nicht eher ein billiger Trick von Politikern, die Nationalgefühl für ihre fragwürdigen Ziele ausnutzen wollen? Ausgerechnet ein Brite sagte einmal: „Patriotism is the last refuge of a scoundrel.“ (Patriotismus ist die letzte Zuflucht eines Schurken.) Ist Patriotismus nicht nach den Kriegen des 20. Jahrhunderts dermaßen überlebt, dass die Menschen jeden Politiker aus dem Amt lachen müssten, der es noch wagt, Patriotismus einzufordern?
Perspektiven
Die Frage des 21. Jahrhunderts muss lauten: Wie schaffen wir ein Europa, das allen Einwohnern Frieden und ein Auskommen garantiert, ein Europa, in dem die bürgerlichen Freiheiten respektiert werden und jede Art von Diskriminierung total „out“ ist? Die Errungenschaften der Französischen Revolution werden somit weiterentwickelt als Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für ganz Europa. Ein Europa, das die Menschenrechte im ganzen Kontinent garantiert und schützt, wäre auch ein attraktives Modell für den Rest der Welt. Dort würden die meisten Menschen sagen: So etwas wollen wir auch bei uns. Die Vision: An einem solchen europäischen Wesen könnte die Welt genesen.
Der Realisierung dieser Vision steht derzeit ein großes Hindernis im Weg: Nein, ich meine jetzt nicht die Barrieren in vielen Köpfen, sondern die existierende Weltwirtschaftsordnung mit ihren Verflechtungen und global fließenden Kapitalströmen, die noch immer, wie Karl Marx und Friedrich Engels schon 1848 schrieben, um den Globus rasen auf der Jagd nach noch mehr Profit. Die gnadenlose Ausbeutung der Schwächeren treibt auch die Flüchtlinge aus armen Ländern nach Europa, die in ihrer Verzweiflung sogar ihr Leben auf überfüllten Seelenverkäufern im Mittelmeer riskieren.
Europa hat darauf leider noch nicht die wirklich passende Antwort gefunden, passend zum Anspruch einer „Wertegemeinschaft“. Dabei sind unsere Politiker nicht blind: Einige haben vorgeschlagen, den armen Ländern so zu helfen, dass die Flüchtlinge eine Perspektive sehen, sich im Herkunftsland zu ernähren. Doch greifen einige Millionen Entwicklungshilfe aus unseren Steuergeldern viel zu kurz. Nur ein systembezogener Eingriff in wirtschaftliche Machtverhältnisse würde die Perspektive nachhaltig verbessern. „Global Players“, große Konzerne, wo auch immer sie ihren Stammsitz haben und Geld in Steueroasen verstecken, müssten mit eingebunden werden und sich soweit Zurückhaltung auferlegen, dass Schwache in benachteiligten Regionen nicht ruiniert werden.
Doch wer kann sich vorstellen, dass die existierende Geldgier-Ordnung des globalisierten Neoliberalismus sich auf etwas Anderes einließe als Aussichten auf weitere Gewinnsteigerungen? Wer jetzt sagt, das sei eben im System so festgeschrieben, da könne man nichts machen, der lässt sich vom „Erfolg“ dieses Systems blenden. Erst einmal ist es kein festes System mit Regeln, sondern eher ein Haifischbecken. Zweitens wird es immer wieder von Krisen erschüttert: Mal platzt eine Aktienblase an der Börse, mal eine Immobilien-Spekulationsblase, deren Schockwellen eine Weltwirtschaftskrise bewirken. *
Und bei alldem sind es (selbst bei den vielen computergesteuerten Automatismen) immer noch menschliche Köpfe, die denken, lenken und dabei auch mal Fehler machen. Und wer weiß, ob sich nicht bald auch in den neoliberal verseuchten Hirnwindungen einmal eine Erkenntnis Bahn bricht, die den Sinn all dieses hektischen Raffens in Frage stellt und eine Umorientierung ermöglicht?
Wer das für utopisch hält, sollte sich fragen, ob er sich nicht besser gleich in den Sarg legen und auf das Ende warten sollte. Wenn alles so weiterläuft, schafft der Mensch die Menschlichkeit ab und damit auch sich selbst. Wie war das noch mit König Midas im griechischen Mythos? Er bekam seinen Wunsch erfüllt, dass alles, was er anfasse, zu Gold würde. Die Folge: Auch das, was er essen oder trinken wollte, wurde vor seinen Lippen zu Gold…
-SR- April 2014
.
6. „Friede auf Erden“ – ein Wort zum Pazifismus
Wenn man es so sehen will, kann man den Pazifismus unter die utopischen Ideen der Menschheit einreihen. Denn wenn man die Geschichte im Längsschnitt betrachtet, findet man nirgendwo eine historisch belegte Epoche, in der es keine kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben hätte. Daraus kann man schließen, dass es auch in Zukunft keinen dauerhaften Frieden auf Erden geben wird.
Man kann aber auch den entgegengesetzten Schluss ziehen und lauter fordern, dass damit endlich Schluss sein müsse, weil endlich Konsequenzen aus den vielen leidvollen Erfahrungen der Menschheit gezogen werden müssten. Und das sei nicht utopisch, sondern möglich – denn der Mensch alias Homo Sapiens legt schließlich Wert darauf, vernunftbegabt zu sein, und die Vernunft rät eindeutig dazu, Konflikte friedlich zu lösen.
Nun, eine kleine Minderheit von Kriegsgewinnlern mag es vernünftig finden, dass Kriege ihnen satte Profite in die Kasse spülen. Aber, wie jeder Mensch weiß, trifft das auf die überwältigende Mehrheit nicht zu: So gut wie alle Menschen wollen in Frieden leben, ohne Todesangst vor mordenden Soldaten oder Massenvernichtungswaffen, sie wollen eine Lebensperspektive mit Aussicht auf ein wenigstens bescheidenes Auskommen, auf Familie und Freundschaftsbeziehungen, auf ein geregeltes Zusammenleben in einem geordneten Gemeinwesen.
Überall da, wo Krieg und Gewalt herrschen, werden diese Bedürfnisse missachtet und mit Füßen getreten. Es ist nicht der Mehrheitswille, der einen Krieg oder Bürgerkrieg vom Zaun bricht, der Terror gegen die Zivilbevölkerung und den Zusammenbruch wirtschaftlicher Strukturen begrüßen würde. Das wohlverstandene allgemeine Interesse will so etwas nicht. Überall auf der Welt wissen die Menschen, dass ein Leben in Frieden wünschenswert ist.
Der altgriechische Dichter Pindaros, der um 500 v.Chr. lebte, schrieb:
Scheint süß ja der Krieg nur dem, der ihn nicht kennt,
schaudert, wenn er naht, vor ihm übers Maß im Herzen.
Diejenigen, die Krieg wollten, suchten ihn immer zu verharmlosen, oft unterschätzten und verklärten sie ihn sogar selbst als großes Abenteuer und Bewährungsprobe für „harte Männer“, als Chance auf Ruhm und Ehre. Auf vielen Darstellungen von Schlachten der Vergangenheit sieht man daher wenig Schreckliches, einige Wenige sterben im Bild Heldentode; so sieht man auch im Bild in Beitrag 9 unten (Schlacht bei Königgrätz) wenig von der Schlacht, also keine von Säbelhieben gespaltenen Köpfe und entstellten Leiber, keine von Kanonenkugeln zerrissenen Körper, und auch nicht die von Kartätschen zerfetzten Leichen von Menschen und Pferden.
Wieso gab es eigentlich an einigen Punkten in der Geschichte so etwas wie Kriegsbegeisterung, wieso gab es Gewaltausbrüche und Pogrome? Das kann nur daran liegen, dass Aufwiegler es verstanden, eine Stimmung zu verstärken und mit von ihnen gesteuerten Vorstellungen zu verbinden, dass es einen Feind gebe, der nun bekämpft werden müsse, und dessen Bosheit so groß sei, dass kein Reden, sondern nur noch Gewalt helfe.
Man sieht mit Erstaunen, wie oft in der Geschichte vernunftbegabte menschliche Wesen auf Kriegsparolen abfuhren oder hereinfielen und tatsächlich zu glauben bereit waren, die zum „Feind“ erklärten Menschen seien „die Bösen“, auf der eigenen Seite walte dagegen das Gute und Gerechte. So arbeitet die Kriegspropaganda: Wir sind die Guten, wir kämpfen einen „gerechten Krieg“, aber die Anderen sind die Bösen, die uns nehmen wollen, was wir haben, und uns an den Kragen gehen. Daher werden im Krieg Schandtaten der eigenen Soldaten möglichst verschwiegen, die des Feindes aber angeprangert zum „Beweis“: Seht, wie böse die sind!
Noch schlimmer wütet der aggressiv gemachte Mob, wenn Religion missbraucht und zu irdischen Zwecken eingesetzt wird. Da wird das Gemetzel zum Gottesdienst erklärt, die Welt soll von bösen Teufeln gereinigt werden, usw. So kann man Menschen in die Irre leiten, die zuwenig Menschenkenntnis, zuwenig Lebenserfahrung, zuwenig Weltläufigkeit besitzen, um den Schwindel kritisch zu hinterfragen. Denn solche Hetze verfängt nur in Köpfen, in denen ein unrealistisches Menschenbild haust, das egozentrisch, wie die Made im Sprichwort, den eigenen Käse für die Welt hält, das bezweifelt, ob die Fremden überhaupt Menschen sind, ja ob es überhaupt Menschen geben darf, die anders denken, anders aussehen, andere Lebensgewohnheiten oder eine andere Gottesvorstellung haben.
Wenn sich Menschen mit solch engem Weltbild zusammenrotten, sich gegenseitig bestärken und aufstacheln, dann kommt es zu Ausschreitungen, Pogromen, Verfolgung von Minderheiten. Und ein solches Gewaltpotential lässt sich auch auf erklärte Feinde lenken, wenn man Krieg plant. Oft sind es gerade die „kleinen Leute“, die geschundenen, ausgebeuteten, deren angestauter Frust sich leicht in gewalttätige Aktionen leiten lässt.
Das kann zu Situationen führen, in denen an der Front ein armer Schlucker dem anderen an die Gurgel geht, nur weil sie verschiedene Uniformen tragen. Dabei hätten sie Grund genug, ihre Gemeinsamkeiten zu erkennen und sich gegen ihre Unterdrücker zusammenzutun. Man kennt auch Erzählungen von Soldaten, die den Feind beobachteten und plötzlich erkannten, dass da auch nur Menschen waren wie sie, und daraufhin nicht auf diese schießen konnten. Das, und nicht das Kriegsgebrüll, ist die wahre menschliche Verhaltensweise!
„Where have all the flowers gone?“ ist ein bekanntes Lied, zumindest in der Generation, die in den USA und dann auch in Europa in den 1960er Jahren gegen den Vietnamkrieg und in den frühen 1980er Jahren gegen die Nato-Nachrüstung mit Atomraketen protestierte und demonstrierte. In dem Lied heißt es: „When will they ever learn?“ (in der deutschen Fassung: „Wann wird man je verstehn?“).
Es gäbe wohl kaum noch Kriege, wenn die Soldaten erkennen würden: Wir sollen auf Unseresgleichen schießen, wir haben aber keinen Grund zum Morden. Daraufhin würden die meisten ihr Gewehr in die Ecke stellen und sagen: Tschüss, da mache ich nicht mit, ich gehe nach Hause! Zurück blieben vielleicht ein paar Gewalttäter und Sadisten. Wenn die sich dann draußen gegenseitig umbrächten, wäre das nicht ganz so schlimm – zumindest wäre die friedliebende Mehrheitsgesellschaft sie los.
Aber dieser „Idealfall“, wenn man so will, tritt ja selten ein. Vielmehr sind die Geschichtsbücher voll von Berichten, wie Soldaten bzw. bewaffnete Banden marodierend die Zivilbevölkerung terrorisierten – oder sogar auf „Befehl von oben“ Gräueltaten verübten, vergewaltigten und plünderten, „verbrannte Erde“ hinterließen. Leider hören wir dazu auch aktuelle Beispiele in den Nachrichtensendungen. Und gerade deshalb ist die Frage aktuell: Warum hört Homo Sapiens nicht endlich auf mit diesem Kriegswahnsinn?
Schaut auf den Menschen, und verschont uns mit den höheren Zielen, für die es sich zu sterben lohnte! Heldentod für die nationale Ehre, Töten für den Glauben, und all dieser Kitsch und Schwachsinn, das gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Hört endlich auf, Phrasen zu dreschen, statt von den wahren menschlichen Werten zu reden! Statt den Tod zu verherrlichen, solltet ihr das Leben preisen, das euch euer Gott geschenkt hat, und davon reden, wofür es sich zu leben lohnt. So wird am ehesten Wirklichkeit, was Manche altklug als Utopie abtun wollen: Friede auf Erden…
-SR- im Juli 2014

Beati pacifici – selig sind die Friedfertigen (eine der Seligpreisungen aus der Bergpredigt)
Bodenmosaik in der romanischen Kirche Groß-Sankt-Martin in Köln
Ergänzung im September 2016: Viele Menschen glauben, es könnte doch bei uns im zivilisierten Europa keinen Krieg mehr geben, schon weil alle für Frieden sind und die Abwesenheit von Krieg zu schätzen wissen. Doch stimmt das, können wir da beruhigt sein? Erfahrungen aus jüngster Vergangenheit warnen uns: Seid wachsam. Ein Beispiel ist der Jugoslawien-Krieg: Die Menschen, die in Jugoslawien friedlich zusammenlebten, konnten sich um 1990 noch nicht vorstellen, dass in den Jahren danach Slowenen, Serben, Kroaten, Bosnier sich gegenseitig überfallen und aufeinander schießen würden.
Und schaut Euch an, was in der Ost-Ukraine vor sich geht… ! —
++++++++++
Dazu ein Essay vom August 2024: „Und den Menschen — ein Wohlgefallen?“ Hier anklicken >Pazifismus aktuell—
.
7. Rückschritt – ja, bitte!
Diese Überschrift ist nicht etwa unsere neueste Marschparole, und wir sind auch nicht vom Überdruß an der Moderne gepackt. Hier geht es vielmehr um das, was in einem Beitrag oben (in 5.) schon als „Barriere in den Köpfen“ erwähnt wurde und das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen mitbestimmt. Eingefahrene Denkgewohnheiten, archaische Gefühlsmuster, atavistische Vorstellungen von der Welt und ihrer „natürlichen“ Ordnung, das sind solche Barrieren, die nicht nur dem Fortschritt oft im Weg stehen, sondern sogar zu Rückfällen in vorzeitige, überholte Muster führen können und damit Fortschritte zunichte machen.
Wovon reden wir hier? Menschen brauchen Orientierung, und je mehr sie von ihrer gegenwärtigen Welt verwirrt und verunsichert sind, desto eher greifen sie auf alte, scheinbar bewährte und verlässliche Ansichten und Verhaltensmuster zurück. So bekommen in Krisenzeiten die Vertreter konservativer oder gar rückständiger Parolen und Ansichten die Chance, bei Menschen Gehör zu finden. Wer scheinbar sicheres Terrain anbietet, zu dem flüchten sich die auf schwankendem Boden Stehenden.
Wer noch tiefer verunsichert ist, glaubt selbst althergebrachten Heilmitteln nicht mehr und verfällt dem Wunderglauben an selbsternannte Heilsbringer, die ganz neue Wundermittel anpreisen und den Weg zum Heil zu kennen vorgeben. Begabte Volksredner und Leute mit charismatischer Ausstrahlung gewinnen in solchen Zeiten leicht eine große Zahl von Anhängern.
Werden wir konkret. Wenn z.B. Hitler das „Führerprinzip“ in Politik und Gesellschaft propagierte, zugleich die Demokratie (speziell die Weimarer Republik) verächtlich machte, dann zeigte er gern mit dem Finger auf negativ erscheinende Seiten der parlamentarischen Demokratie, lobte als positives Gegenbeispiel gegen endlose Debatten und Parteienschacher die Tatkraft und Klarheit eines starken Führers — und präsentierte sich selbst als Retterfigur für das Land.
Das schien Manches für sich zu haben, zumal im Volk die Sehnsucht nach dem „starken Mann“ verbreitet war, der in eine gesicherte Zukunft führen, aber auch die hergebrachte Welt in Ordnung bringen und heilen sollte. Das Volk war an autoritäre Strukturen gewöhnt — sowohl in der Familie, der „Keimzelle des Staates“ (!), wie auch in Politik und Gesellschaft. Bis 1918 hatte es einen Kaiser an der Spitze des Staates. Dann fehlte eine (Landes-)Vaterfigur, die ab 1925 von „Ersatzkaiser“ Hindenburg verkörpert wurde, der aber Hitler im Januar 1933 den Weg zur Macht im Staate öffnete, indem er ihn zum Reichskanzler ernannte.
Hitler tat alles, um diese Macht zu behalten und für sich auszubauen: Er setzte die Verfassung Stück für Stück de facto außer Kraft, vereinigte sofort nach dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg (1934) die Ämter von Reichspräsident und Reichskanzler, vereidigte die Wehrmacht auf seine Person, und nannte sich fortan „Führer und Reichskanzler“. Der entmachtete Rumpf-Reichstag nickte es ab. (Im Volksmund war das Parlament nur noch der „Reichsgesangsverein“, weil er, eh nur noch selten einberufen, seine Hitler-Bejubelungs-Sitzungen mit dem Absingen der Nationalhymne beendete.)
Um an alte, im historischen Bewusstsein verankerte Vorstellungen anzuknüpfen, verkündete Hitler den Aufbruch in ein „Drittes Reich“, mit dem das 1919 durch den Versailler Vertrag gedemütigte Deutschland zu neuer Größe aufgerichtet werde. Besonders sein Propagandaminister Goebbels fand Worte und Begriffe, die ein Bild positiver Erwartung in die Köpfe pflanzte, das bis zu einer pseudoreligiösen Heilserwartung gesteigert wurde. Goebbels scheute sich nicht, Hitler zu einem Messias der Deutschen zu verklären.
Das gekränkte kollektive Selbstbewusstsein wurde gebauchpinselt mit dem Lob auf das deutsche Wesen, gekoppelt mit der „Säuberung des deutschen Kulturlebens“ von allem „undeutschen“ Geist. Damit konnten die Nazis sowohl alles Moderne, vom Gros des Volkes Unverstandene verbannen (z.B. „entartete Kunst“), als auch ihren rassistischen Kampf gegen alles Jüdische inszenieren (und damit wertvolle Teile des deutschen Kulturlebens und der Wissenschaft ins Exil treiben).
Man braucht nur an Heinrich Heines populäres Lied von der Lorelei zu erinnern, dessen Autor in Nazi-deutschen Liederbüchern ein angeblich „unbekannter Dichter“ war, um den Krampf dieser willkürlichen Trennung von jüdischen und – ja was denn – „deutschen“ Kulturschaffenden zu erkennen. Die jüdisch-stämmigen Deutschen waren genauso Deutsche wie die als „arisch“ bezeichneten. Überhaupt war diese ganze „Rassentheorie“ wissenschaftlicher Humbug, da konnten „Rassen“-Forscher noch so viele Messungen an Schädeln usw. anstellen. Aber besonders in Diktaturen finden sich immer auch Wissenschaftler, die ihrer Karriere zuliebe gern politisch erwünschte „wissenschaftliche Erkenntnisse“ liefern.
Die Verfälschung der Wahrheit gelingt der rassistischen Propaganda oft leicht, denn Menschen trennen sich nicht gern von liebgewordenen Vorstellungen und Vorurteilen. Und an Vorurteile wussten die Nazis anzuknüpfen! Das „gesunde Volksempfinden“ wurde gelobt und hofiert, sogar Richter wie der gefürchtete Volksgerichtshof-Präsident Roland Freisler nahmen ausdrücklich darauf Bezug. „Zigeuner“, Homosexuelle und andere, nicht ins Wunschbild des „normalen“ Deutschen passende Menschen wurden ins KZ gesteckt, drangsaliert, ermordet. Damit wurden angeblich „Schädlinge aus dem gesunden Volkskörper entfernt.“
(Eine solche Phrase sollte eigentlich jedem vernunftbegabten Menschen signalisieren: Hier reden Unmenschen. Ihre Untaten sollen durch „höheren Blödsinn“ gerechtfertigt werden.)
Der „normale“, meist vorurteilsbehaftete Deutsche billigte dieses Vorgehen, da er die „Blut-und-Boden“-Mentalität einer agrarisch geprägten Gesellschaft akzeptierte, die Fremdenfeindlichkeit für normal hielt und Außenseiter mobbte und vertrieb. Dabei stand eine solche Mentalität (schon damals!) in krassem Widerspruch zur Realität eines Industrielandes mit internationalen Handelsbeziehungen.
Auf diesem Morast des angeblich „gesunden Volksempfindens“ geht die Saat der Fortschritts-Feindlichkeit auch heute bei einigen Menschen immer noch auf. Wir leben in einer verstädterten Welt, in der der eher weltoffene Lebensstil des Städters die Gesellschaft prägt — und doch gibt es verunsicherte Gemüter, die sich für überholte Ansichten und Parolen gewinnen lassen. Das ist nichts Anderes als ein Leben im falschen Film, d.h. mit dem falschen Bewusstsein, das nicht zur Wirklichkeit passt.
Wer das in evolutionsbiologischer Perspektive sieht, stellt fest: Klar, die Menschheit lebte zehntausende von Jahren als Jäger und Sammler, danach Jahrtausende als Bauern. Erst seit ca. 150 Jahren bildeten sich im Gefolge der Industrialisierung die meisten Städte und Großstädte. Oberflächlich nahmen die vom Land Zugezogenen in der Stadt bald die Lebensformen des Städters an, doch tief im Bewusstsein saß die Herkunft vom Land, aus dörflichen Gemeinschaften… und prägte in verklärter Erinnerung eine Nostalgie nach ländlicher Idylle.
Das lässt sich nicht so schnell löschen. Es braucht sowohl für den Einzelnen wie für Gesellschaften lange Zeit, um neue Traditionen zu etablieren, die der modernen, verstädterten Welt angepasst sind. Dann werden aus Menschen mit engem, xenophoben Horizont, aus vom Fortschritt Verunsicherten, solche, die Fremden vorurteilsfrei und weltoffen begegnen, die eine Weltbürger-Mentalität entwickeln, die sich also nicht allein in einem engen lokalen Rahmen verwurzelt sehen, und die auch nationalistische Überheblichkeit als dumme Ignoranz erkannt und abgelegt haben.
Zu einer solchen Einstellung kann man leicht kommen, wenn man einen gewissen Bildungsstandard erreicht und versteht, dass es auf der Welt viele „beste“ Völker und Kulturen gibt — die alle im Prinzip gleichwertig sind, denn überall haben Menschen versucht, im Rahmen ihrer Lebensbedingungen ein sinnvoll strukturiertes Gemeinwesen zu bauen. Fremde Kulturen sind nicht „fremd“, sie erscheinen uns nur so, weil wir nicht in diesen Ländern gelebt haben und erst einmal unseren eigenen Käse für „normal“ halten: „Die Made hält ihren Käse für die Welt.“ Man kann aber auch ohne einen weiten Bildungshorizont, nämlich durch persönliche Begegnung und Erfahrung, erkennen: Die Fremden sind auch nur Menschen, sie haben dieselben Grund-bedürfnisse wie wir, und es gibt eine große Menge Gemeinsamkeiten.
Wenn man auf Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern schaut, so fragt man sich teilweise, ob sie wirklich im 21. Jahrhundert angekommen sind. Manche scheinen
den Wandel der modernen Welt noch nicht verarbeitet zu haben und sträuben sich gegen den Abschied von alten Vorurteilen, wollen keine Weltbürger werden, verschließen die Augen vor dem Zusammenwachsen der Welt zum „globalen Dorf“, reagieren im Gegenteil auf Globalisierung und weltumspannende Kommunikation mit Rückzug ins Nationale, Regionale und Lokale und verklären die Vergangenheit zu einer kuscheligen Idylle, die es so weiß Gott nicht gab.
Das wäre nicht so schlimm, wenn damit nicht auch alte Werte, die einer früheren, vorindustiellen Gesellschaft angepasst waren, wieder aufleben würden. Die Rückschritts-Orientierung ist verhängnisvoll, denn sie gaukelt Menschen vor, in eine „gute, alte Zeit“ zurückkehren zu können. Das bedeutet Realitätsverlust und Sehnsucht nach einer Utopie: „Rückschritt — ja, bitte!“ ist keine Verheißung, sondern eine Bedrohung, die dem ganzen Land schadet: Mit dieser Mentalität setzt man falsche Ziele. So besteht man sicher nicht die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts — im Gegenteil: Man hat plötzlich auch noch mit Problemen zu tun, die längst der Vergangenheit angehören sollten.
Also: Begreift, dass die Welt sich wandelt und nicht alles bleiben kann, wie es früher (auch nicht) gewesen ist! Blickt nach vorn! Werdet citoyens, und bemüht euch, euren Horizont zu erweitern, werdet Weltbürger!
S. R. 29.08.2014
 .
.
8. Lokal, regional, national, kontinental und global
oder: Das Allgemeine findet sich im Konkreten – und umgekehrt
Wie jede Geschichtslehrerin und jeder Geschichtslehrer weiß, kann den EinsteigerInnen in das weitläufige Feld der Geschichte nur schrittweise und nur teilweise die komplexe Stofffülle, dosiert in verdaulichen Happen, nahegebracht werden. Zum Glück gibt es in der Vermittlung der Geschichte ja den Begriff des Exemplarischen: Man greift zu einer für eine Epoche, ein Phänomen, ein häufig auftretendes Forschungsproblem, oder was sonst, einen typischen Fall heraus, der als Beispiel dient und es zunächst erübrigt, alle dazu passenden Fälle zu erwähnen und zu behandeln.
Dieses Prinzip findet Anwendung, wenn etwa die Stadt des Mittelalters betrachtet wird und man dazu als Beispiel eine Stadt wählt, die ausreichendes Quellenmaterial bietet und über eine längere Entwicklung verfügt. Die Schulgeschichtsbücher wählen als Beispiel oft die Stadt Köln, die ja bereits um Christi Geburt entstand und im Mittelalter zur größten Stadt Deutschlands aufblühte.
Wer über dieses Einstiegsstadium hinaus sich weiter interessiert oder gar weiter forschen möchte, stößt fast schon in jedem Reiseführer (nicht nur von Florenz, Prag oder London) auf eine kurzgefasste Stadtgeschichte, die ihm, auf der Basis seines o.a. Einsteigerwissens, erste Anhaltspunkte für weitere Fragen bietet. An Geschichte interessierte Menschen wollen natürlich — über exemplarische Fälle hinaus — früher oder später mehr über ihren Geburts- bzw. Heimatort wissen und sichten die (oft nur spärlich verfügbaren) Informationen.
Die Beschäftigung mit der Geschichte Frechens muss zwangsläufig eingebettet sein in die regionale und allgemeine Geschichte (siehe >Frekena: „Wie Frechen entstand“ 1+2, „Wie kam Audomar nach Frechen?“). Denn Vieles ist quellenmäßig kaum belegt, für Frechen gilt das bis ins späte Mittelalter. Daher muss Manches durch Rückschlüsse und Analogien aus der regionalen und überregionalen Geschichte erschlossen werden. Soll heißen: Wo uns konkrete historische Details fehlen, können wir zumindest annehmen, dass Vieles ähnlich ablief wie in anderen Orten oder Regionen, aus denen mehr Informationen vorliegen.
Für Neuzeit und Zeitgeschichte liegt dagegen vielfältiges Quellenmaterial zu Frechen vor. Dennoch ist eine Stadtgeschichte immer auch mit der regionalen und allgemeinen Geschichte verwoben. Das zeigt sich (geradezu exemplarisch) beim Blick auf die zeitgeschichtliche und jüngste Vergangenheit Frechens, die bis an die Gegenwart heranreicht. Der Historiker W. R. stellt dies im folgenden Beitrag dar:
8.1 Frechen und die Industrie
… oder: die Industrie und Frechen? Auf jeden Fall war und ist es eine enge Beziehung. Und – es ist eine Medaille, die man von zwei Seiten betrachten kann. Einerseits bedeutet Industrie am Ort Arbeitsplätze und womöglich ein gutes Einkommen für viele Einwohner. Andererseits bedeutet sie je nach Sparte Lärm, Dreck und verschmutzte Luft, bei Abbau von Bodenschätzen auch Wegbaggern der Landschaft, der Heimat, und Umsiedlung von Dörfern.
Das alles ist im Allgemeinen bekannt. Nur: Der Teufel liegt im Detail, und hier stellt sich konkret die Frage: Mit welchen Nachteilen wurden Vorteile erkauft, und wie sieht eine mögliche Bilanz von Verlust und Gewinn für den Ort Frechen aus?
Was konkret den Braunkohle-Tagebau westlich von Köln betrifft, so könnte man den historischen Ablauf wie folgt beschreiben: Da kommen Großunternehmer, die bereits im Osten, in Mitteldeutschland, mit dem Abbau von Braunkohle in großem Stil erste Erfahrungen gemacht haben, ins Rheinland und sehen sich den gekleckerten Abbau in vielen kleinen und kleinsten Gruben an, kommen zu dem Schluss, dass sich hier mit größerem Kapitaleinsatz großflächig große Gewinne machen lassen, und fangen an, Land zusammenzukaufen, um große Abbaugebiete zu bilden, die man mit Maschineneinsatz in großem Stil ausbeuten kann.
Man nimmt Geld in die Hand und bietet den Landbesitzern schnelles Cash, das viele sehr verlockend finden, und den Einwohnern umzusiedelnder Dörfer an anderem Ort die Möglichkeit, sich in moderneren Neubauten einzurichten. Wer trotzdem an der Heimat hängt und nicht wegziehen will, muss erleben, wie sich sein Dorf entvölkert, wie erste Häuser verfallen oder abgerissen werden, und dass bald die Kneipe, der Bäcker und der Dorfladen dicht machen. Was vertraute Heimat und lebenswert schien, zersetzt sich zusehends. Wer will da noch bleiben, wenn er nicht den Vorsatz gefasst hat, aus Prinzip der Übermacht die Stirn zu bieten?
Doch der Widerstand stößt an Grenzen: Das Land hat Gesetze gemacht, die die Großunternehmen mit den nötigen Möglichkeiten ausstatten, ihre Interessen zum Wohle der Allgemeinheit (z.B. Sicherung der Energieversorgung) gegen Einzelinteressen durchzusetzen. Wer gegen Abbaupläne klagt, scheitert an diesen legalen, d.h. per Gesetz aufgerichteten Barrieren. Und Widerstand regt sich ohnehin kaum, da die Interessen kaum divergieren: Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften arrangieren sich mit dem größten Arbeitgeber in der Region, Stadt- und Gemeinderäte nehmen vom ohnehin größten Gewerbesteuer-Zahler großzügige Hilfen bei gemeinnützigen Projekten (z.B. Sportstätten) entgegen, und viele Vereine der Region erhalten Spenden bzw. Sponsorengelder. Wer will da den Mund aufmachen und laute Kritik äußern, um womöglich als Querulant ins Abseits gestellt zu werden?
Dies alles greift ineinander wie eine gut geölte Maschinerie. Oft sind die kommunalen Entscheidungsträger ja auch personell verbandelt mit dem größten Arbeitgeber der Region, z.B. sitzen Angestellte des Großunternehmens auch als Stadtverordnete in Gemeinderäten, Stadtparlamenten, oder im Kreistag und im Landtag, und manch ein hochrangiger Angestellter wechselt in politische Ämter oder in leitende Funktionen in Landesministerien, und ggf. wieder zurück. Da wundert es niemanden, dass es bei politischen Entscheidungen auf kommunaler, Kreis- und Landesebene selten Interessenkollisionen zwischen dem Großunternehmen und der Politik gibt.
Deshalb sind, wie oben schon gesagt, die Interessen des Großunternehmens fast deckungsgleich mit dem Allgemeinwohl, was dann auch in Gesetzesform für den Bergbau gegossen wird. So prallen Proteste von Bürgern gegen neue Abbaugruben und damit verbundene Landenteignungen und Umsiedlungen an der gültigen Rechtslage ab, die quasi natur- und gottgegeben das Großunternehmen schützt. Wer auch immer im Land regiert, es sind mehrheitlich Kohlefreunde.
Frechen hat damit konkret inzwischen nicht mehr viel zu tun: Die großen Braunkohlegruben auf der Ville, die um die Mitte des 20. Jahrhunderts u.a. die Umsiedlung von Benzelrath, Grefrath und Habbelrath verlangten, sind längst Geschichte, sind rekultiviert, d.h. neu gestaltet als Ackerland oder Forstgebiete. In der Landschaft am Papsthügel oder Boisdorfer
See lässt sich gut radeln und wandern, und im Verlauf von Jahrzehnten entsteht so etwas wie eine Erholungslandschaft, der man bald nicht mehr ansehen wird, dass sie neu angelegt wurde und keine in Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft ist.
Sicher, es fehlen hier die historischen Siedlungen, Landmarken, Kirchtürme und Burgen – doch in zwei bis drei Generationen werden sie nicht mehr vermisst; das 21. Jahrhundert schlägt in Büchern mit alten Fotos die Erinnerung an Geschichte und Heimat nach, von der die Großeltern früher erzählt haben. Deren Kinder fanden Arbeit bei Rheinbraun, und z.T. noch bei RWE Power, bis auch dort Arbeitsplätze rar wurden. Zugleich wurden Proteste gegen neue Riesengruben lauter, für die RWE große Altwälder (Hambacher Forst) rodet und weitere Siedlungen und historische Bauten abräumt. Angesichts einer sich verändernden Lage in der Energie-Erzeugung und -versorgung wurde auch die Braunkohle-Verstromung zunehmend als wenig effizient, aber Schadstoffe emittierend und sehr klimaschädlich kritisiert.

Quarzsand-Abbau in Frechen: Ganz hinten erkennt man die Säulen des Buchenwaldes (2010), links neue Aufforstungen
Im Schatten des großflächigen Abräumens von Landschaft für den Braunkohle-Tagebau fällt dann kaum noch auf und ins Gewicht, dass am Rande von Frechen noch weiter gebaggert wird: Für den Abbau von Quarzsand verschwindet alter Buchenwald zwischen dem Quarzsandwerk und der Autobahn A4. Zwar forstet auch die Quarzwerke AG im Rücken ihrer Bagger die Grube neu auf, doch auch hier hinterlässt der Tagebau eine nachhaltig veränderte Landschaft.
Was dem menschlichen Auge höchstens indirekt erkennbar wird, ist z.B. die Absenkung des Grundwasserspiegels infolge der tiefen Grabung, wo ständig Grundwasser abgepumpt wird, damit die Grube nicht vollläuft. Das Flüsschen Erft fließt friedlich dahin, ist aber in Wahrheit längst ein künstliches Gewässer, gespeist aus dem abgepumpten Grubenwasser — und damit auch reguliert, sodass es nicht mehr die Überflutungen und Sümpfe im Erfttal gibt wie noch im 19. Jahrhundert. Und der Frechener Bach, der früher durch Frechen floss, existiert nur noch theoretisch in einem Abschnitt entlang der Bahngleise zwischen Frechen und Stüttgenhof.
Der Braunkohletagebau mit seinen immensen Abpump-Mengen hat u.a. Schäden an historischen Gebäuden nach sich gezogen, die dem Abbaggern entgangen sind: Schloss Türnich z.B. erlitt Risse im Mauerwerk, weil die Eichenholzstützen, die vor Jahrhunderten in den sumpfigen Boden der Erftniederung gerammt wurden, durch die Absenkung des Grundwasserspiegels trocken fielen und zu verfaulen begannen. Ähnliches geschah an Teilen von Schloss Bedburg und anderswo.
den sumpfigen Boden der Erftniederung gerammt wurden, durch die Absenkung des Grundwasserspiegels trocken fielen und zu verfaulen begannen. Ähnliches geschah an Teilen von Schloss Bedburg und anderswo.
Doch ehe Rheinbraun bzw. RWE Power die Eigentümer entschädigte, mussten diese z.T. langwierige Prozesse führen. Die Schäden an Schloss Türnich etwa sind beträchtlich, das Hauptgebäude (Foto links von 2015) ist seit Jahrzehnten unbewohnbar. Eine Einigung zwischen den streitenden Parteien kam erst vor Kurzem zustande.
Ein anderes Problem ist der Feinstaub, den der Wind in der trockengelegten Grube aufwirbelt und hinausträgt. Das fällt sogar dem menschlichen Auge auf, das beim Besuch an den großen Braunkohlegruben von Hambach und Garzweiler sieht, welche Wolken gröberen Staubs sich bei stürmischem Wind erheben. Anwohner der umliegenden Ortschaften bemängeln, dass Messstationen für Feinstaub z.T. nicht dort stehen, wo sie nötig wären.
Schon fernab von Frechen, vor Erkelenz, liegt Garzweiler II, wo noch viel Kohle gefördert werden soll. Problem 1: In den heutigen Abbaugebieten liegt der Kohle-Flöz sehr viel tiefer als z.B. damals auf dem Villerücken. Es wird also viel mehr Abraum bewegt, folglich entsteht auch ein bedeutend größeres und tieferes Loch in der Landschaft als in den früheren Abbaugebieten. Durch tief gehende Grundwasserabsenkung werden damit auch weiter entfernte Gebiete in Mitleidenschaft gezogen, wo Feucht- und Waldgebieten Austrocknung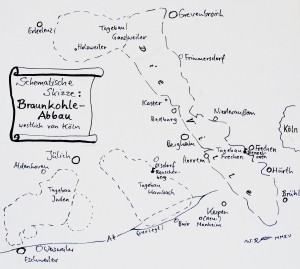 droht.
droht.
Problem 2: Was passiert nach der Auskohlung des Riesenlochs? Der Betreiber will z.B. für den Tagebau Inden eine kostengünstige Lösung: Statt Auffüllen mit Abraum ein Volllaufenlassen mit Wasser. Die von RWE Power favorisierte Lösung soll der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht werden als neues Erholungsgebiet an einem See bei Inden, mit Wassersportmöglichkeiten etc. Kritiker warnen vor dem enorm tiefen Gewässer („Indener Ozean“), das biologisch weitgehend tot bleiben würde. Außerdem könnte es dort lange Zeit immer wieder zum Abrutschen von Hang- und Uferteilen kommen, zumal es Jahrzehnte dauern würde, bis der See vollgelaufen wäre.
Und angesichts der jüngsten Entwicklung auf den Feldern der Energie- und der Klimapolitik wird der Sinn des Großprojekts Garzweiler II angezweifelt. Überhaupt ist es fraglich, inwieweit diese Rahmenbedingungen den Braunkohletagebau langfristig noch wirtschaftlich machen — auch wenn die Lobby von RWE Power, Vattenfall und anderen Interessierten ihren Einfluss geltend machen wird, damit für sie die Weichen günstig gestellt werden.
Frechen hat, wie gesagt, mit dem Wirtschaftssektor Energieerzeugung nicht mehr viel zu tun. Die Stadt hat in den vergangenen Jahrzehnten auf diese absehbare Entwicklung reagiert und einen Strukturwandel hin zum Sektor Handel und Dienstleistungen vollzogen. Viele Firmen haben sich – in verkehrsgünstiger Lage zu den Autobahnen – neu angesiedelt. Die Stadt hat neue Gewerbegebiete erschlossen und vermarktet, nachdem sie 1975 Marsdorf an Köln abtreten musste.
Frechens Verhältnis zur Industrie muss man also heute mit anderen Augen sehen. Nur noch wenige Industriebetriebe sind vor Ort, die meisten Arbeitsplätze bieten längst die Firmen in Handel und Dienstleistungsbereich. Selbst die Quarzwerke mit Abbau und Aufbereitung von Bodenschätzen bieten heute weniger Arbeitsplätze als noch vor einigen Jahrzehnten — infolge fortschreitender Maschinisierung, Automatisierung und Computersteuerung. Von den vielen Steinzeugwerken des vorigen Jahrhunderts ist allein Rhenania an der Kölner Straße geblieben. Auf dem Gelände der ehemaligen Steinzeugfabrik Cremer&Breuer entstand ein weiteres Gewerbegebiet – was sonst?
Rückblickend mag jeder für sich entscheiden, wie das Verhältnis von Gewinn und Verlust für Frechen in seiner Beziehung zur Industrie war und ist. Ob jemand den Verlust historischer Substanz wie z.B. von Burg Benzelrath hoch, weniger hoch oder verschmerzbar findet, hängt sehr von seiner persönlichen Einstellung ab. Wer Sinn für Geschichte und Denkmalschutz hat, muss diesen Verlust bedauern. Aber diesen Sinn findet man nicht überall, auch nicht immer bei den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik.
Hier bewahrheitet sich im Zweifel der alte Spruch: „Wenn Einer ein Ding von zwei Seiten sehen kann, hat er bestimmt kein Geld darin stecken.“ Wo satte Gewinne winken, setzt man sich umso 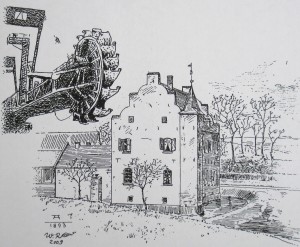 leichter über Bedenken hinweg: Das sah man schon bei der Niederlegung der Spiesburg mitten in Frechen 1830, als das Burggelände parzelliert und verkauft wurde. In Köln verfuhr man ähnlich mit der großen mittelalterlichen Stadtmauer, kaum dass der Dom im Jahre 1880 endlich fertiggestellt war. Und Rheinbraun verzichtete 1954 auch nicht auf die Beseitigung der Burg Benzelrath (Abb. rechts) am Rande des Abbaugebietes; denn in diesem Bereich stand der Kohleflöz sozusagen dicht unter der Grasnarbe, sodass man leicht an viel Kohle kam.
leichter über Bedenken hinweg: Das sah man schon bei der Niederlegung der Spiesburg mitten in Frechen 1830, als das Burggelände parzelliert und verkauft wurde. In Köln verfuhr man ähnlich mit der großen mittelalterlichen Stadtmauer, kaum dass der Dom im Jahre 1880 endlich fertiggestellt war. Und Rheinbraun verzichtete 1954 auch nicht auf die Beseitigung der Burg Benzelrath (Abb. rechts) am Rande des Abbaugebietes; denn in diesem Bereich stand der Kohleflöz sozusagen dicht unter der Grasnarbe, sodass man leicht an viel Kohle kam.
Die Entscheider in der Chefetage hatten ein anderes Wertesystem im Kopf als die Kritiker, die es schon damals gab, und die die Burgen gern erhalten hätten. Doch für die Abbau-Entscheider in den Chefetagen war es weder ihre Heimat, noch lag ihnen viel an der Erhaltung historischer Bauwerke in einer ihnen fremden, zur wirtschaftlichen Ausbeutung überlassenen Region. Und die, deren Heimat verschwand, hatten sie für ein Linsengericht verkauft, das noch ihre Kinder satt machte, aber ihre Enkel schon nicht mehr um es einmal in biblischer Sprache mit den Worten einer Weissagung des späten Mittelalters zu formulieren (vgl. W. Reinert, DIE BEATUS-CHRONIK, S. 74).
Der historische Bilderbuch-Ort Kaster, heute ein Stadtteil Bedburgs, verdankt sein Überleben
auch nur heimatliebenden Kritikern, die Gehör bei der Regierung des (damaligen) Landkreises Köln fanden. Der Regierungspräsident erweichte Rheinbraun, das historische Kaster zu verschonen. Weniger Glück hatte z.B. Burg Reuschenberg südwestlich von Elsdorf: Am Rande des neu erschlossenen Abbaugebietes „Hambach I“ gelegen, wurde sie 1998/99 abgeräumt, wie eine Anzahl anderer historischer Burganlagen in den Jahrzehnten zuvor.
Jahrzehntelang war das Hauptargument für Rheinbraun und gegen Kritik: Es schafft Arbeitsplätze für die Region. Tatsächlich waren Braunkohle-Abbau und -verarbeitung sowie -verstromung in Kraftwerken lange der größte Arbeitgeber im (heutigen) Rhein-Erft-Kreis. Und heutzutage, da die Zahl seiner Arbeitsplätze rückläufig ist, wird gern angeführt: RWE Power schenkt uns große Erholungsgebiete mit einer tollen Seenlandschaft, die es früher nicht gab. Zusätzlich wird seit einigen Jahren gern ein „grüner“ Aspekt ins Feld geführt: Im Rekultivierungsgebiet siedeln sich z.T. seltene Pflanzen und Tiere an, manche waren hier früher sogar fremd. Sowas nennt man Imagepflege, Kritiker sprechen von „Greenwashing“.
Doch infolge der „Energiewende“ verkündete die rot-grüne Landesregierung im März 2014, dass der geplante Abbau im Gebiet Garzweiler II nicht in vollem Umfang nötig sei und deshalb für den am spätesten vorgesehenen Teil der Abbau nicht mehr durchgeführt werde, was für das Dorf Holzweiler mit umliegenden Gehöften bedeutete, sie müssten sich nicht mehr auf eine Umsiedlung um 2030 einstellen.
In der Krise um die Krim-Annexion und die Ost-Ukraine 2014 meldeten sich prompt Stimmen, die die Sicherheit der Energieversorgung ins Spiel brachten: Man dürfe die Braunkohleförderung nicht zurückfahren, damit Deutschland nicht zu sehr von russischen Gaslieferungen abhinge. Da versucht man noch ganz schnell die Kurve zu kriegen und die alte Planung zu retten.
Andererseits fragt man sich, warum sich RWE Power nicht schon längst stärker im Sektor „erneuerbare Energien“ engagiert hat. Das war offenbar bewusste Konzernpolitik: Man setzte stur weiter auf Braunkohle und Atomkraft. Und dann wurde man von der Ankündigung der „Energiewende“ auf dem falschen Fuß erwischt.
RWE Power war völlig unvorbereitet, vielleicht weil es bis dahin keine Probleme in der Zusammenarbeit mit der Politik gegeben hatte und man glaubte, dass man vor sowas wie der „Energiewende“ sicher sei, hatte doch erst kurz vorher die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Merkel den Atomkonsens der rot-grünen Regierung mit der Atomindustrie gekippt und die Laufzeiten der AKWs verlängert.
Nun könnte jemand denken: In oder im Umkreis von Frechen gibt es kein AKW, also, was kümmert mich dieses Thema? Was uns daran kümmern muss, weiß inzwischen jeder informierte Bürger: Seit der Katastrophe im AKW Tschernobyl, weit weg in der West-Ukraine, wissen wir, welche großräumigen Folgen ein „Störfall“, aber erst recht ein GAU (größter anzunehmender Unfall) in einem AKW haben kann. 1986 nahm dieser GAU praktisch einen großen Teil Europas, auch unsere Region, in Mitleidenschaft.
Damals redeten sich Atomwirtschaft und Politik noch damit heraus: Das war ein schlechter Ostblock-Reaktor, unsere guten Anlagen dagegen sind anders und völlig sicher. Aber als der GAU im hochtechnisierten AKW von Fukushima in Japan am 11.3.2011 eintrat, zog diese Ausrede nicht, und Kanzlerin Merkel reagierte schnell, schon am 14.3.: deutsche AKWs 3 Monate abschalten und überprüfen, und mittelfristig alternative (d.h. regenerative) Energiegewinnung ausbauen mit dem Fernziel, Atomstrom entbehrlich zu machen (Atomausstieg). Hinzukommen sollte für den Klimaschutz auch die Abkehr von der Braunkohle als „schmutzigstem“ Energieträger. Das nannte man wohlklingend „Energiewende“.
Wie alle wissen, ist diese „Wende“ noch lange nicht vollzogen (Stand: August 2015). Es türmten sich Schwierigkeiten auf, Energiekonzerne zierten sich, beschwerten sich, drohten mit Schadenersatzklagen, und bald gab es Ärger um neu zu ziehende Stromtrassen für den Stromtransport aus den Windparks des norddeutschen Flachlandes in den Süden der Republik. Und in den Medien trommelten Konzernsprecher und einige Politiker unisono dafür, die Braunkohleverstromung als unverzichtbare „Brückentechnologie“ sowie als Reserve noch lange zu nutzen… Wir wollen das Thema an dieser Stelle nicht weiter vertiefen.
Klar ist: Der Rhein-Erft-Kreis, ja die Region zwischen Köln und Aachen, sind von der RWE-Konzernpolitik wie von der Energiepolitik der Landes- und der Bundesregierung in hohem Maße betroffen. Hier greift, für alle offensichtlich, Lokales, Regionales und Überregionales ineinander — und das eigentlich schon seit Beginn der großflächigen Braunkohlegewinnung im späten 19. Jahrhundert. Wer eine Geschichte Frechens bis in unsere Zeit schreiben will, wird nicht umhin kommen, neben dem Focus auf das lokale Geschehen auch die oben kurz angesprochenen Zusammenhänge in den Blick zu nehmen.
W.R., im August 2015
Links für Leute, die sich genauer informieren wollen…
… zum Thema Braunkohle:
Rheinisches Braunkohlerevier DE – Rheinisches Braunkohlerevier – Wikipedia
BUND. Landesverband Nordrhein-Westfalen: Braunkohle
Schloss Türnich: Ein Wasserschloss kämpft gegen Bergschäden | Burgerbe-Blog
Buch: Frank Kretzschmar, Kulturregion Erftkreis: Verluste einer Denkmallandschaft. 1991
Film, ausgestrahlt vom WDR am 3.3.2017 >Das große Loch – Heimat gegen Kohle – Doku am Freitag – Sendung – Video – Mediathek – WDR
Ein aktuelles Update im Dez. 2019: Keyenberg – Verheizte Heimat
Ausführliche Darstellung zur Entwicklung um Abholzungen im Bereich Hambacher Forst und Proteste dagegen: Hambacher Forst – Wikipedia
Aktualisierung/Update 24.01.2020 zum Stand der Dinge, mit Focus auf NRW: Kohleausstieg – DER SPIEGEL
… zum Thema Rekultivierung:
Braunkohle: Wald ist nicht gleich Wald | ZEIT ONLINE
… zum Thema Quarzsandabbau:
Sehr geehrter Herr Reith, – Erwiderung Brief Quarzwerke BUND.pdf
Quarzwerke in Frechen: Sandabbau kann weitergehen | Frechen – Kölner Stadt-Anzeiger
… zum Thema Atomkraft:
>Blog / 11.3.2014: „11. März — ein Ge- und Bedenktag“
… zum Thema Energiewende:
Das Zeitalter der Erneuerbaren beginnt | Greenpeace
Energiewende: Nicht ablenken lassen | ZEIT ONLINE
Da soll mal einer sagen, Zeitgeschichte sei nicht spannend – zumal dann, wenn ihr Schauplatz die eigene Heimat bzw. Wohngegend ist! Es mag zwar nicht von Bedeutung sein, wenn (nach einem populären Spruch) in China ein Sack Reis umfällt. Aber wenn an einem Konferenztisch in Essen, in der Konzernzentrale von RWE Power, Pläne für die Zukunft diskutiert und beschlossen werden, dann hat das durchaus Folgen auch für die Region zwischen Köln und Aachen.
Und was den Sack Reis betrifft, so würden Verfechter der Chaostheorie sagen: Vorsicht, keine voreiligen Schlüsse! Und Wirtschafts-Analysten und Börsen-Beobachter würden mit erhobenem Finger beipflichten — mit Blick auf Chinas Börsen-Turbulenzen im Sommer 2015. So gesehen, ist der Spruch vom Sack Reis veraltet und passt nicht mehr in unsere globalisierte Welt: China ist längst Teil des „globalen Dorfes“ — das haben schon u.a. deutsche Großinvestoren besorgt, die in China nicht nur Autos verkaufen und bauen, sondern auch viel Geld in die dortige Kohleindustrie gesteckt haben.
-S. R.-
Im Dezember des Jahres 2021 konnte man feststellen: Die Regierungen unter Kanzlerin Merkel haben Manches an Problemen liegen lassen oder nur halbherzig bearbeitet. Um ein Datum des Kohleausstiegs wurde Jahre gefeilscht und verhandelt, ähnlich wie zuvor um den Atomausstieg, und Energiekonzerne schlugen dabei Milliarden an Entschädigung für sich heraus.
 Wie zuvor um den Erhalt des Hambacher Forsts (genauer: eines Reststückes davon) wurde im Jahr 2021 erbittert um den Erhalt einiger Dörfer im westlichen Tagebaugebiet Garzweiler II gestritten. RWE versteifte sich darauf, dass der Tagebau wie geplant auch das Dorf Lützerath einschließe. Hier konzentrierte sich daher auch 2021 der Protest. Das Plakat mit Aufruf zu einer Demo vom Oktober 2021 stellt ausdrücklich den Zusammenhang mit den von der Politik angestrebten Klimazielen her.
Wie zuvor um den Erhalt des Hambacher Forsts (genauer: eines Reststückes davon) wurde im Jahr 2021 erbittert um den Erhalt einiger Dörfer im westlichen Tagebaugebiet Garzweiler II gestritten. RWE versteifte sich darauf, dass der Tagebau wie geplant auch das Dorf Lützerath einschließe. Hier konzentrierte sich daher auch 2021 der Protest. Das Plakat mit Aufruf zu einer Demo vom Oktober 2021 stellt ausdrücklich den Zusammenhang mit den von der Politik angestrebten Klimazielen her.
Und in der Tat erklärt der neue Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) Anfang 2022, dass Deutschland aufgrund jahrelanger Versäumnisse im Klimaschutz hinter den selbst gesteckten Zielen zurückliege und diese nicht nur 2021 verfehlt habe, sondern auch 2022 nicht erreichen werde.
.
Was ist ein Baudenkmal? Es ist ein Überbleibsel aus vergangener Zeit, das selten und außergewöhnlich geworden ist. Und mehr noch, es ist eine Brücke in die Vergangenheit, die sonst dem Auge nicht mehr direkt sichtbar ist. Ein Baudenkmal hilft uns, wenn wir uns eine versunkene Zeit vorstellen wollen, wenn wir sie bis in Einzelheiten sinnlich erfahrbar kennenlernen wollen. Es ist Historie zum Anfassen, Begehen, Sichhineinversetzen.
.
8.2 Lokales Baudenkmal
als Hinweis auf eine weltgeschichtliche Entwicklung:
Der Bahnhof „Belvedere“ in Köln-Müngersdorf
.
Am Tag des offenen Denkmals im September 2016 entschloss ich mich, an einer Führung an und in einem Baudenkmal teilzunehmen, das der Öffentlichkeit bis auf Weiteres nicht zugänglich ist. Durch einen Zeitungsartikel neugierig gemacht, besuchte ich zuvor die Homepage des Fördervereins, der sich für die Erhaltung dieses Objektes einsetzt >Willkommen bei – Förderkreis Bahnhof Belvedere e.V. . Das war für mich der Eintritt in ein Thema, das ich bisher nur gelegentlich in Geschichtsbüchern gestreift hatte: Die Anfänge der Eisenbahngeschichte, eng verbunden mit der Entwicklung der Dampfmaschine, diese wiederum ein wesentlicher Teil der Industriellen Revolution, die in England im 18. Jahrhundert ihren Anfang nahm und im 19. Jahrhundert auf das europäische Festland, die USA und schließlich große Teile des Globus übergriff.
Es ist der Schönheit dieses Bauwerks, seiner Einzigartigkeit in Deutschland, und der kompetenten Führung an jenem Tag geschuldet, dass ich verstärktes Interesse an diesem Themenbereich entwickelte und nicht nur dem Förderkreis beitrat, sondern mich auch in Literatur zum Thema vertiefte. Einen guten kulturhistorischen Überblick und konkreten Einblick in die Entstehung dieses Bahnhofs im Zusammenhang der Planung und Bedeutung der Eisenbahnstrecke liefert der Vortrag von Prof. Norbert Nußbaum (mit Bildern) auf der o.g. Homepage: >Vortrag Belvedere 23-05-13_MS.pdf
Das Bahnhofsgebäude, erbaut 1838/39, mit der heute parkartigen Anlage ist einzigartig, weil es aus dieser frühen Zeit des Eisenbahnwesens in Deutschland sonst kein derartiges Gebäude mehr gibt. Man hatte zu jener Zeit noch gar kein Vorbild für den Bautyp „Bahnhof“ und orientierte sich daher an anderen Beispielen, wie der Vortrag ausführt. Ebenso zeigt sich auch am rollenden Material jener Zeit, dass man (aus heutiger Sicht) noch gar nicht so recht wusste, wie man Lokomotiven und Waggons am zweckmäßigsten konstruieren sollte.
Die ersten Lokomotiven, die noch aus England importiert wurden, waren quasi auf Räder gestellte Dampfmaschinen, zur Personenbeförderung nahm man zunächst die Oberbauten von Kutschen und montierte sie auf ein für den Schienenverkehr geeignetes Fahrgestell. Für die billigsten Plätze gab es offene Waggons, wo Ruß und glühende Partikel aus dem Rauch der Lokomotive so manchen Ausgehanzug einsauten und so manches Kleid durch Brandlöcher ruinierten.
Aber diese möglichen „Kollateralschäden“ nahm man in Kauf, das Kölner Publikum jedenfalls begrüßte und nutzte die Möglichkeit der Ausflugsfahrten nach Müngersdorf, wo man sich im Gartenlokal ergehen und den Blick nach Köln bis ins Bergische Land („Belvedere“ = schöne Aussicht) genießen konnte. Diese erste Teil- (und Test-) Strecke, eröffnet 1839, erfreute sich regen Zuspruchs, wie auch später die Fahrt weiter bis Großkönigsdorf, wo Ausflügler aus Köln Waldspaziergänge und die Erfrischung in mehreren Gartenlokalen schätzten.
Die als „Eiserner Rhein“ geplante Eisenbahnlinie musste hinter Großkönigsdorf den Höhenrücken der Ville überwinden. Statt einer zuerst erwogenen Umgehung der Ville baute man mit beträchtlichem Aufwand einen Tunnel. Der Streckenverlauf („Rheinische E.B.“) ist in einer Karte des Landkreises Köln aus dem späteren 19. Jahrhundert gut zu erkennen, siehe >Blog, Bach-Revival, gegen Ende des Beitrags. (Der Tunnel wurde Mitte des 20. Jahrhunderts „aufgeschlitzt“, indem man das Deckgebirge abtrug.) An der belgischen Grenze traf die Strecke dann auf den von Belgien vorangetriebenen Streckenteil, sodass die erste grenzüberquerende Eisenbahnlinie Europas 1843 komplett in Betrieb gehen konnte. Eine Datenübersicht zur frühen Eisenbahn-Entwicklung finden Sie hier: >daten-eisenbahn-anfaenge.
Im Londoner Science Museum kann man eine der frühen Lokomotiven von Stephenson besichtigen. Ich fotografierte sie 1997 und stellte dabei mit Bedauern fest, dass ein Teil des Antriebs fehlte, nämlich die Pleuelstange, die die Dampfkraft aus dem Zylinder auf das vordere (Antriebs-) Rad überträgt. Überhaupt machte die Lok auf mich den Eindruck, als sei sie auf einem Schrottplatz gefunden und nach einer Säuberung direkt ins Museum gebracht worden (Foto rechts).
besichtigen. Ich fotografierte sie 1997 und stellte dabei mit Bedauern fest, dass ein Teil des Antriebs fehlte, nämlich die Pleuelstange, die die Dampfkraft aus dem Zylinder auf das vordere (Antriebs-) Rad überträgt. Überhaupt machte die Lok auf mich den Eindruck, als sei sie auf einem Schrottplatz gefunden und nach einer Säuberung direkt ins Museum gebracht worden (Foto rechts).
Eine beigefügte Erläuterung gab Auskunft: Stepenson’s „Rocket“, the first modern steam locomotive, 1829 / technical improvements in the „Rocket“ of 1831 (on display), e.g. front buffer; speed: 29 mph
In der Zeichnung von J. P. Weyer von ca. 1845 (>Abb. im o.g. Vortrag von N. Nußbaum, S. 7) sieht man einen Zug am Bahnhof Belvedere, bereit zur Abfahrt nach Köln. Dort hatte man aus handelspolitischen Gründen schon lange über eine Verbindung zur belgischen Küste nachgedacht, um die Zölle an der niederländischen Rheinmündung zu umgehen. Noch ahnte niemand, wie schnell innerhalb von ein paar Jahrzehnten das Streckennetz wachsen würde — trotz Behinderung durch viele Ländergrenzen (Der deutsche Nationalstaat ohne Staats- und Zollgrenzen wurde bekanntlich erst 1871 gegründet).
Und wenn wenn wir über den Atlantik schauen, sehen wir, dass der Bau der Eisenbahnen die USA erst in die Lage versetzte, den „Wilden Westen“ zu erobern und zu erschließen. Außerdem ermöglichten sie schnelle Truppentransporte im Sezessionskrieg 1861-65, ein Vorteil, den auch das preußische Militär in Deutschland im Auge hatte. Aber vor allem die Wirtschaft nutzte die Transportkapazitäten der Eisenbahn, etwa um Kohle oder Eisenerz zu den Hochöfen zu bringen. Die Industrielle Revolution hielt damit Einzug auch auf dem Kontinent, und bald überflügelte das junge Deutsche Reich in vielen Bereichen sogar Großbritannien, das Mutterland dieser Entwicklung.
In England, und nicht nur dort, gibt es eine Gemeinde von Eisenbahn-Enthusiasten und -historikern, die sich auch um Pflege und Erhalt von Überresten der Eisenbahngeschichte kümmern. Wer sich ausführlich in englischer Sprache über die Entwicklung von den frühen Dampfmaschinen zu den ersten Eisenbahnen informieren will, klicke auf diesen Film (45 Min.) von National Geographic: >Britain’s Greatest Machines With Chris Barrie – S02E04: Trains – The Steam Pioneers (5.1 DPL II, HD) – YouTube .
Als ich Anfang der 1980er Jahre im Süden Englands auf der Suche nach einer B&B-Unterkunft war, verschlug es meine Begleiterin und mich unverhofft in ein ruhiges, teils bewaldetes, kleines Tal auf dem Lande, wo wir einen alten, stillgelegten Bahnhof vorfanden. Die Besitzer betrieben hier eine Bed-and-Breakfast-Pension für Eisenbahn-Fans und hatten den Bahnhof liebevoll in allen möglichen Details restauriert. Man schlief in Abteilen, an den Fenstern waren Emaille-Schilder angeschraubt: „Do not lean out.“ Das Dach des Bahnsteigs wurde von schlanken Eisensäulen getragen, deren Kapitelle in floralen Formen ausfächerten. (In ähnlichem Stil kann man solche Bauelemente noch am Bahnhof Rolandseck sehen — oder in der Kölner Flora.)
Dieser Bahnhof stammte nicht aus der Frühzeit wie unser Belvedere, aber auch dort war im Laufe der Zeit ein fast märchenhaftes Ensemble entstanden. Jenes Tal wirkte völlig weltabgeschieden, wie aus der Zeit gefallen; die alten Bahngleise waren nur noch nahe am Bahnhof vorhanden. Ich weiß nicht, ob sich jenes Idyll bis heute als private Initiative halten konnte. Unserem Bahnhof Belvedere, weniger weltabgeschieden, wird es hoffentlich in ein paar Jahren vergönnt sein, nicht nur als ein historisches Kleinod, sondern auch als beliebter Veranstaltungsort zu strahlen.
Bis dahin sind noch einige Probleme zu lösen, im Jahre 2016 vor allem der Konflikt zwischen  Naturschutz (Erhaltung der nahe am Bau hochgegangenen Platanen) und Denkmalschutz (Erhaltung der Bausubstanz, die an der Nordwestseite durch starke Baumwurzeln geschädigt wird). Aus meiner Sicht sollte eine Gesamtbetrachtung möglich sein, die das ganze Ensemble in den Blick nimmt und nicht nur ein Teilinteresse, so berechtigt es auch im Allgemeinen ist. So sieht man die nähere Umgebung (Bahnhofsgarten und Böschung der Mittelterrasse entlang des Militärrings) reich bestückt mit Baum und Busch. Aus meiner Sicht bedeutet das: Im Rahmen einer Gesamtbewertung wäre es evtl. zu verschmerzen, wenn am Bahnhof ein (zum Naturdenkmal erklärter) Baum für den Erhalt des Baudenkmals geopfert wird. Da die anderen Platanen stehen bleiben, würde auch der Eindruck der Garten- bzw. Parkanlage nicht beeinträchtigt.
Naturschutz (Erhaltung der nahe am Bau hochgegangenen Platanen) und Denkmalschutz (Erhaltung der Bausubstanz, die an der Nordwestseite durch starke Baumwurzeln geschädigt wird). Aus meiner Sicht sollte eine Gesamtbetrachtung möglich sein, die das ganze Ensemble in den Blick nimmt und nicht nur ein Teilinteresse, so berechtigt es auch im Allgemeinen ist. So sieht man die nähere Umgebung (Bahnhofsgarten und Böschung der Mittelterrasse entlang des Militärrings) reich bestückt mit Baum und Busch. Aus meiner Sicht bedeutet das: Im Rahmen einer Gesamtbewertung wäre es evtl. zu verschmerzen, wenn am Bahnhof ein (zum Naturdenkmal erklärter) Baum für den Erhalt des Baudenkmals geopfert wird. Da die anderen Platanen stehen bleiben, würde auch der Eindruck der Garten- bzw. Parkanlage nicht beeinträchtigt.
W. R., im November 2016
Nachtrag zum Stand der Problembewältigung vom 22.04.2017 >Restaurierung: Der erste Schritt am Bahnhof Belvedere ist gemacht | Kölnische Rundschau
und >Förderkreis Bahnhof Belvedere e.V. – Aktuell
Update am 27.06.2024: Kaum zu glauben, aber der die Bausubstanz gefährdende Baum ist immer noch nicht gefällt! Sturheit ohne Rücksicht auf die Gesamtsituation, so würde ich die Blockadepolitik der treibenden Kraft gegen die Baumfällung nennen. Das kann nicht im öffentlichen Interesse sein, denn es schadet nicht nur dem Baudenkmal, es schadet auch dem Ansehen des Naturschutzes. Siehe dazu auch: >Leserbriefe zum Bahnhof Belvedere: Naturschutz ad absurdum geführt | Kölner Stadt-Anzeiger
P.S. Als heiteres Bonbon kann man sich hier ein Filmchen anschauen, das in der Stummfilmzeit entstand und die ersten Eisenbahnen karikiert (Dauer: 4:50min.): >1829 Stephenson’s Rocket steam locomotive – YouTube
 .
.
.
9. Beurteilung von historischen Persönlichkeiten und persönliche Urteile
Von Helden, Schurken und persönlicher Sympathie
.
Friedrich Schiller, der sich nicht nur bei den Recherchen zu seinen Dramen mit Geschichte beschäftigte, schrieb über Wallenstein, den er zum Helden seines gleichnamigen Zweiteilers machte:
Von der Parteien Gunst und Hass verzerrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.
Das kann man zum Bild so mancher Persönlichkeit sagen, die uns in historischen Darstellungen begegnet. Mal ist es die Perspektive des Zeitgeistes einer Epoche, mal die Sympathie oder Voreingenommenheit eines Autors, die eine Persönlichkeit der Geschichte in positiven oder negativem Licht erscheinen lässt.
Dazu kann man etwa das Beispiel Alexander der Große anführen, der seit der Antike als gefeierter Feldherr und Halbgott erscheint, den man aber auch ganz anders bewerten kann (mehr >F.U.F.-Bibliothek / Der Animus-Preis / Matthias Schulz).
Wieso kam es überhaupt dazu, dass jener Alexander der über Epochen hinweg strahlende Held wurde? Als die europäische Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert aufblühte, war eine Sehweise verbreitet, die man unter dem Schlagwort „Männer machen Geschichte“ zusammenfassen kann. Verstärkt wurde diese Anschauung dadurch, dass man Geschichte weitgehend als eine Folge von Feldzügen und Kriegen betrachtete, über die auch das meiste Quellenmaterial vorlag. Und aus den Quellen ergab sich fast zwangsläufig, dass große Feldherren und mächtige Herrscher die Völker und ihre Geschicke lenkten, dass es an ihnen hing, ob Reiche aufstiegen oder untergingen.
So ergingen sich Historiker in ihren Wälzern darin, große Herrscher anzuschwärmen und erfolgreiche Feldherren zu bewundern — z.B. ebenjenen Alexander. Den himmelten schon viele antike Autoren an, römische schmückten ihn mit dem Beinamen „der Große“, und antike Herrscher schon nahmen sich Alexander zum Vorbild. Vom römischen Kaiser Augustus wird berichtet, dass er persönlich das Grab Alexanders in Alexandria besucht und zum Zeichen der Verehrung einen goldenen Lorbeerkranz spendiert habe.

Bismarck und Generalstabschef Helmuth von Moltke während der Schlacht von Königgratz (3.7.1866), nach einem Gemälde von C. Röchling, ergänzt von W.R. Die Anekdote hierzu: König Wilhelm drängte Bismarck, Moltke über den zu erwartenden Ausgang der Schlacht zu befragen. Bismarck ritt an Moltke heran und bot dem „Schweiger“ sein Zigarrenetui. Moltke wählte mit Bedacht und nahm sich eine. Darauf ritt Bismarck zum König zurück und meldete: „Majestät, es steht gut für uns: Er hat sich die beste genommen.“
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass so mancher deutsche Historiker des 19. Jahrhunderts es ihm (Augustus) am liebsten gleich getan hätte. Diese Sehweise der Geschichtsschreibung hatte erst richtig Konjunktur, als im späten 19. Jahrhundert das zweite deutsche Kaiserreich errichtet war (1871). Man bewunderte die preußischen Siege in den „Einigungskriegen“ und erzählte Anekdoten vom preußischen König und späteren Kaiser Wilhelm I. und seinen Generälen, wie zuvor schon vom „Alten Fritz“. Man sah „große Männer“ der deutschen Geschichte das Deutsche Reich errichten, wie — allen voran — Bismarck.
Wen wundert es, dass man am Deutschen Eck in Koblenz 1897 eine Reiterstatue Kaiser Wilhelms I. auf einem hohen Sockel in einem weitläufigen Denkmalsgelände aufstellte. Die Aufschrift auf dem Sockel lautete: „Wilhelm dem Großen.“
 Monumental-Reiterstatue des Kaisers, begleitet von einem geflügelten Genius, am Deutschen Eck in Koblenz (Foto anklicken zum Scharfstellen), aus: Unser Kaiser, 1898, S. 365
Monumental-Reiterstatue des Kaisers, begleitet von einem geflügelten Genius, am Deutschen Eck in Koblenz (Foto anklicken zum Scharfstellen), aus: Unser Kaiser, 1898, S. 365
Noch zahlreicher waren allerdings Denkmäler für Bismarck, gern als monumentale „Bismarck-Säule“. Eine solche wurde 1903 auch in Köln-Bayenthal am Rheinufer errichtet, inzwischen ist sie in hohen Bäumen teilweise versteckt. Wie beliebt das Prinzip „Männer machen Geschichte“ war, zeigt sich auch an der Konvention, bestimmte historische Gestalten mit dem Beinamen „der Große“ zu versehen. In den Genuss dieser Auszeichnung kamen nur wenige Frauen, genauer: die russische Zarin Katharina die Große. Ansonsten kennen wir Kaiser Konstantin den Großen (natürlich von der christlichen Kirche so benannt), Kaiser Karl den Großen (dto.), Kaiser Otto den Großen, König Friedrich den Großen, Zar Peter den Großen… Im oben erwähnten Fall von Kaiser Wilhelm I. hat sich der Beiname allerdings — ungeachtet des Denkmalstextes in Koblenz — nicht durchgesetzt. (Eine Aura historischer Größe wird eher mit seinem Kanzler Bismarck verbunden.)
Mit „Größe“ ist dabei vor allem historische Bedeutung gemeint, weniger Körpergröße, schon gar nicht charakterliche Größe. Letztere wurde den „Großen“ aber gern angedichtet, wenn lobhudelnde Autoren loslegten. Alexander sorgte sogar höchstselbst dafür, dass man ihn im gewünschten Licht sah:
Auf dem extrem strapaziösen Marsch durch die Wüste Gedrosiens litt sein Heer Durst. Da brachte ein Soldat ihm in seinem Helm eine kleine Menge Wasser, die er nahebei aufgetrieben hatte. Alexander nahm den Helm, schüttete das Wasser vor aller Augen aus, und sprach: „Ein Alexander trinkt nicht, wenn seine Soldaten dürsten.“
Diese Anekdote diktierte er auch gleich seinem begleitenden Historiker Kallisthenes in die Feder. Und weitere Schreiber sorgten dafür, dass diese Kunde bald in die Welt hinausging. So war Alexander u.a. auch Vorbild für spätere Propagandisten. Manche Herrscher kannten in dieser Hinsicht gar keinen Respekt vor der Wahrheit oder der Historie: Sie ließen eifrig fälschen. Das begann schon früher, bei den Pharaonen im Alten Ägypten, die den Namen eines missliebigen Vorgängers aus allen Monumenten herausmeißeln ließen.
Als die Karolinger das Frankenreich regierten, bastelten Chronisten eifrig am Ruhm des Herrscherhauses, indem sie die Vorgänger und ihr Wirken in ein möglichst schlechtes Licht stellten. So kamen die Merowinger-Könige im Ganzen schlecht weg, während vor allem Karl der Groß(gelobt)e im Glanz seiner militärischen Erfolge und seiner Kulturförderung („karolingische Renaissance“) erstrahlte und die vorangegangenen Merowinger verblassen ließ.
Auch wenn es ein Theaterdichter und kein Geschichtsschreiber war: William Shakespeare ging ähnlich vor und verkaufte den König Richard III., der dem ersten Tudor-König voranging, seinem Publikum 1592 als Monster und Scheusal (womit er die Geschichte stark verfälschte). Er diente damit politischen Zwecken, indem er den Mythos der Tudor-Monarchie stärkte und damit auch die Herrschaft seiner Königin Elisabeth I. ideologisch festigte. Man darf dabei nicht unterschätzen, dass seinerzeit das Theater sehr populär war und sowohl Unterhaltung bot als auch politische Erziehung. „Richard III.“ zählte seinerzeit zu den beim Publikum beliebtesten Stücken Shakespeares (Mehr zu politischen und historischen Bezügen in Shakespeares Dramen siehe >This wooden O).
Kurzum, ein Historiker muss die Quellen mit Vorsicht genießen, muss, wie oben (→2.a) schon erläutert, „Quellenkritik“ üben und nicht 1:1 glauben, was die Vergangenheit der Nachwelt schriftlich hinterließ, bzw. in manchen Fällen: auftischte. Was sonst an Schwierigkeiten auftauchen kann, wenn wir historische Figuren und ihr Verhalten zu bewerten versuchen, beschreibt ausführlicher ein Beitrag, der sich z.T. mit Carl Diem befasst und hier angeklickt werden kann:
Diem 1.9.2015 (PDF-Datei: „Ist die Debatte um Carl Diem beendet?“) —
W. R.
Ergänzung vom 31.01.2016: Auf >Historische Forschung kann man im dortigen Beitrag 3 sehr gut nachvollziehen, welche Schwierigkeiten sich ergeben oder ergeben können, wenn man die Biografien von Menschen zu erforschen sucht, die im NS-Staat Karriere machten und/oder an Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren, später aber unbehelligt als angesehene Bürger in Deutschland lebten.
.
9.1 Geschichte und Deutungshoheit
.
Wenn wir erst einmal ein betimmtes Bild von einem historischen Vorgang oder Sachverhalt haben und dieses Bild oft genug in Publikationen verbreitet wurde, sitzt es in allen Köpfen — und ist schwer zu korrigieren. Das sehen wir am Beispiel des Neandertalers, der immer noch als Urbild eines ungeschlachten, der Sprache nicht mächtigen Grobians herhalten muss. Und das, obwohl wir alle inzwischen davon gehört haben, dass dieses Bild längst überholt ist und der Neandertaler (homo sapiens neanderthaliensis) dem später in Europa eingewanderten modernen Menschen (homo sapiens sapiens) in vielen Belangen ebenbürtig, in einigen sogar überlegen war.
Aber wir brauchen nicht in die Urzeit und Vorgeschichte zurückzugreifen, auch nicht auf die einseitige, parteiliche (Ver-)Zeichnung des römischen Kaisers Nero; die Geschichte der letzten, sagen wir: 130 Jahre bietet Beispiele, an denen wir auch erkennen können, wie sehr wir oft von überkommenen Vorstellungen bestimmt werden und kaum – oder nur mit Verzögerung – auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse reagieren.
Die Frage ist also: Welche Version vergangener Geschehnisse wird „Geschichte“, wird zur gültigen Darstellung und Deutung der Vergangenheit? Dazu kann man hier als PDF eine Untersuchung an konkreten Beispielen anklicken: > Sansibar, Helgoland und die Deutungshoheit
Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen es schwer ertragen, dass man manche Dinge verschieden deuten oder von verschiedenen Seiten betrachten kann. Man liebt die einfachen Antworten und die gewohnten Deutungsmuster. Das macht es ja auch Populisten in der Politik einfach, Menschen die Welt vereinfachend zu erklären und zu emotionalisieren, wo komplizierte Sachverhalte sachlich analysiert werden müssten.
W. R.
.
9.2 Historische Persönlichkeiten als Leitfiguren der Gegenwart?
In der Zeit der Corona-Pandemie sind viele Menschen nach 2 Jahren der Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen müde und möchten diese Pandemie endlich beenden. Als probates Mittel dazu sehen Viele eine allgemeine Impfpflicht, wie sie z.B. zur Bekämpfung der Pocken vor Jahrzehnten beschlossen wurde. In dieser Diskussion entdeckten Einige bei Goethe Äußerungen, die ganz klar für eine Impfpflicht argumentieren. Es geht dabei um von Eckermann notierte Sätze aus einem Tischgespräch vom 19.02.1831, als Goethe zu einem Blattern-(=Pocken-)Impf-durchbruch in Eisenach Stellung nimmt und sich für die Beibehaltung der im Herzogtum geltenden allgemeinen Impfpflicht ausspricht.
Dazu erschien ein Buch von Manfred Osten mit dem Titel Die Welt, „ein großes Hospital“: Goethe und die Erziehung des Menschen zum „humanen Krankenwärter“. Und dazu wiederum schreibt Markus Schwering am 12.02.2022 im Kölner Stadt-Anzeiger eine Kritik, in der er zunächst Ostens Sicht auf Goethes Äußerungen referiert und dann kritisch beleuchtet, dass Osten den Altmeister quasi als Kronzeugen für die heutige Diskussion heranzieht. Schwering sieht „das Problem einer aktualistischen Kurzschließung verschiedener historischer Horizonte“ — bei einer „Unterschlagung der Epochendifferenz.“
Am Schluss des Artikels fasst Schwering gut zusammen, was wir beachten sollten, wenn wir historische Persönlichkeiten kurzerhand als Lieferanten von Argumenten für heute heranziehen wollen:
Goethe ist nicht unser fiktiver Zeitgenosse, an dessen Tiefsinn wir Eins zu Eins partizipieren könnten. Solches auch degradierte den Dichter letztlich nur zum Spender allemal zitatreifer Weisheiten. Goethe als Vademecum und Lebenshilfe — das wäre im Extremfall ein Rückfall in die gartenlaubenhafte Klassikerverehrung des 19. Jahrhunderts.
Schließlich ist der Dichter nur als Ganzer zu haben: Wer ihn als Quelle unverbrüchlicher Wahrheiten preist, müsste in diesen Preis auch seine Ablehnung der Demokratie, seine Haltung zu Pressefreiheit und Todesstrafe einbeziehen. Da dürften viele dann doch kalte Füße bekommen. Keine Frage: Die „Impfstellen“ sind interessant und einer einordnenden Diskussion wert — zumal sich hier die Bezüge zu unserer Lebenswelt einfach aufdrängen. Trotzdem: Goethe taugt nicht zum Führer aus der Pandemie — dafür ist er einfach zu weit weg. Mit den Herausforderungen unserer Zeit müssen wir schon selber fertig werden.
Daran lässt sich auch erkennen: „Aus der Geschichte lernen“ ist eine gute Idee, aber sie ist nicht immer leicht umzusetzen.
W. R.
.
10. Demokratie: War und ist sie eine überschätzte Regierungsform?
Ein Beitrag zur Debatte um „mehr Demokratie“
Wenn in unserer Zeit eine Debatte um Unzufriedenheit mit der Demokratie im Lande wie in der EU geführt wird und Einige mehr Volksabstimmungen als Verbesserung fordern, lohnt sich ein Blick sowohl in die jüngste wie in die Alte Geschichte: Da wurden schon politische Erfahrungen gemacht, die wir heute zur Orientierung, aber auch zur Versachlichung der Diskussion nutzen könnten.
W. R. hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu einen eigenen Beitrag geschrieben, der hier aufgerufen werden kann: >Demokratie – was ist das eig. Druckversion
Mag sein, dass mit diesem Beitrag das Thema nicht erschöpfend behandelt ist — auf jeden Fall sollte damit nicht die Diskussion beendet werden, vielmehr sollte er Anlass für weitere Gespräche und Diskussionen bieten.
Die Frage der Überschrift, ob die Demokratie nicht überschätzt werde, kann man erst beantworten, wenn vorab klar ist, welche Erwartungen man überhaupt an diese Regierungsform stellt. Hilfreich fand ich den Spruch von Winston Churchill (siehe o.g. Text, S. 7, letzter Abschnitt).
Zum Begriff „Demokratie“ (ins Deutsche meist übersetzt als „Volksherrschaft“) wäre noch klarzustellen: „Demos“ ist nicht im völkischen Sinne der (in unserem Falle) „biodeutsche“ Anteil der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, denn dann müsste es „Ethnokratie“ heißen. Vielmehr bezeichnet „Demos“ das Staatsvolk im politischen Sinne, bei Wahlen die Summe aller Wahlberechtigten. Das sind, einfach gesagt, alle Menschen mit deutschem Pass, also alle deutschen StaatsbürgerInnen.
Ein Sonderthema ist die Frage, inwieweit die EU ein Defizit an Demokratie in ihren Strukturen hat. Diese Frage stellt sich erst recht nach dem Brexit-Votum der Briten vom 23.06.2016. Populisten in Europa sorgen schon dafür, dass diese Frage weiter in der Öffentlichkeit debattiert wird. Doch helfen Referenden weiter, oder nützen sie nur den Neinsagern, die die EU zerschlagen und Europa in viele Nationalstaaten zersplittern wollen — zur Schadenfreude von gewissen Mächten außerhalb der EU?
Während die Propagandisten der Brexit-Kampagne behaupteten, die Briten würden mit dem Austritt aus der EU „die Kontrolle zurückgewinnen“, dürfte es eher dazu kommen, dass sowohl Großbritannien als auch die EU durch den Brexit geschwächt werden. Das wurde den Briten vor dem Referendum aber meist anders dargestellt: Die Brexit-Kampagne arbeitete mit bewusster Desinformation der Bevölkerung, um sie als Stimmvieh vor ihren Karren spannen zu können.
Jetzt könnt ihr darüber diskutieren, in wie weit das real gelaufene Brexit-Referendum demokratisch war oder nicht.* Die Rechtspopulisten Europas jedenfalls jubelten und forderten gleich ähnliche Referenden in weiteren EU-Staaten. Das ist sehr durchsichtig: Leute, die mit Demokratie wenig oder gar nichts am Hut haben, wollen mit demokratischen Mitteln die EU zerstören und ihre eigene Macht vergrößern. Ihre Alternative für Europa: Viele Nationalstaaten grenzen sich wie in früheren Zeiten gegeneinander ab, jeweils geführt von autoritär regierenden Machthabern, die Unzufriedenheit auf Ausländer und Flüchtlinge umlenken, und notfalls dazu auch Konflikte mit Nachbarstaaten schüren. So etwas kennen wir schon, das ist überlebte Vergangenheit; nur Desorientierte, Faschisten, politisch Unbedarfte und — ja, Verzeihung, ein paar Vollidioten — trauern jener Zeit nach.
Was war am Brexit-Referendum demokratisch? Der bloß technische Vorgang der Abstimmung aller Wahlberechtigten (soweit sie teilnahmen)? Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau hätte dazu wohl gesagt: In diesem Referendum hat sich die »volonté de tous« als numerische Mehrheit geäußert, aber nicht die »volonté générale«**, denn letztere ist durch Falschinformationen eher betäubt worden. Anders gesagt: Die Leute haben abgestimmt, aber mehrheitlich nicht in ihrem eigenen, wohlverstandenen Interesse, und auch nicht im Sinne des Allgemeinwohls (auf das nach Rousseau die volonté générale gerichtet ist). Leider geschieht ähnliches oft auch bei anderen Urnengängen. Aber die WählerInnen werden durch ihre Stimmabgabe beteiligt — auch an der Verantwortung.
Wer mitbestimmt, übernimmt Mitverantwortung. Ist allein das nicht schon Grund genug, sich vor einem Wahlgang gründlich zu informieren und sich nicht allein auf knallige Parolen zu verlassen?*** Demokratie bedeutet, dass die Bevölkerung Verantwortung übernimmt und sie nicht an eine autokratische Führung oder einen Diktator abgibt. Demokratie funktioniert technisch gesehen durch Abstimmungen, denen aber ein Prozess der Diskussion und Meinungsbildung vorausgehen muss.
Das reicht nicht, um Demokratie inhaltlich zu definieren. Oh ja, Da gibt es auch eine inhaltliche Füllung des Begriffs, und darum kann nicht jede Regierung, die durch Abstimmung an die Macht kam, von sich ohne Weiteres behaupten, sie sei eine demokratische.
Vom Volk gewählt heißt: beauftragt. Wozu beauftragt? Für das ganze Land, für die gesamte Bevölkerung Politik zu machen. Klar, in einem System mit politischen Parteien sind die Regierenden auch ihrer Partei, d.h. deren Programm verpflichtet. Aber übergeordnet steht das Interesse des ganzen Landes. Das bedeutet auch, Politik nicht nur für bestimmte Gruppen zu machen und andere zu benachteiligen, also nicht die eine Gruppe auf Kosten der anderen zu bevorteilen. Und schon gar nicht kann es angehen, Minderheiten zu ignorieren oder gar sie zugunsten der Mehrheit zu unterdrücken und auszubeuten. In der Demokratie gilt daher auch das Prinzip Minderheitenschutz.
Solche Inhalte der Demokratie leiten sich vom Grundsatz ab, dass alle StaatsbürgerInnen politisch gleich viel gelten, dass sie vor dem Gesetz gleich sind, und dass der Staat nicht willkürlich in ihre Rechte eingreifen darf, die in der Verfassung und den geltenden Gesetzen definiert sind. Darum gilt in der Demokratie das Prinzip des Rechtsstaates. Der übergeordnete, grundlegende Gedanke ist in den Menschenrechten niedergelegt. Darauf bezieht sich ausdrücklich der Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Diese Verfassung wurde vor allem vor dem Hintergrund der erlebten Willkürherrschaft der Nazis formuliert und beschlossen. Das sind also keine theoretischen Spinnereien, sondern Lehren aus den teuer erkauften Erfahrungen der Nazi-Diktatur. Haltet euch das vor Augen, bevor ihr leichtfertig über unsere Verfassung meckert!
Und der Historiker fügt hinzu: Wenn ich die deutsche Geschichte über die Jahrhunderte überblicke, kann ich feststellen: Noch nie zuvor war die bürgerliche Freiheit in Deutschland so gut geschützt wie in dieser Verfassung, die am 23. Mai 1949 unter der Bezeichnung „Grundgesetz“ in Kraft trat. Und die StaatsbürgerInnen tun gut daran, wachsam darauf zu achten, dass diese Verfassung respektiert und praktisch befolgt und umgesetzt wird. Es gibt immer Punkte, an denen die Umsetzung in die Praxis verbessert werden kann oder sogar muss. Aber das ist eben Aufgabe nicht nur der Institutionen, die die Einhaltung der Verfassung kontrollieren sollen, sondern auch Aufgabe jedes Menschen mit deutschem Pass.
W. R.
____________________
* Man könnte noch weiter gehen und fragen, ob Premierminister Cameron im Zeichen egoistischer, kurzfristiger, innerparteilicher Taktik überhaupt berechtigt war, dem Wahlvolk eine Frage von solcher Tragweite zu stellen und darüber abstimmen zu lassen..
** zentrale Begriffe in seiner politischen Theorie, ausführlich nachzulesen in seinem Hauptwerk „Du contrat social“ (Der Gesellschaftsvertrag) von 1762
*** Wie der Wahlausgang in den Präsidentschaftswahlen der USA im November 2016 zeigte, geht es immer noch schlimmer. Aufgeputschte Emotionen führen zu politisch naiven Wählerentscheidungen, sogar im mächtigsten Land der Welt wird ein egozentrischer Dummschwätzer an die Spitze gewählt, der ohne Plan und ohne angemessenes Verständnis der Weltpolitik nicht in der Lage ist, auch nur einen einzigen vernünftigen Programmpunkt zu formulieren. Menschen mit politischer Bildung haben das in einem Land, das ein Vorbild für Menschenrechte und Demokratie war, nicht für möglich gehalten. Man rätselt seitdem: Wurde das möglich durch die große Zahl von Abgehängten, die sich von den reichen Establishment-Politikern nur hingehalten und verkauft fühlen? (Man betrachte dazu näher die politischen und Vermögensstrukturen in den USA.) Doch inzwischen sieht man auch den Anteil der im Netz gestreuten Hetze und Fake News sowie andere Aktivitäten im Internet deutlicher als Mitwirkende, z.B. aus Russland.
11. Was macht ein(e) HistorikerIn?
Wer sich für Geschichte interessiert und sich damit beschäftigt, ist zunächst einmal ein geistig reger und neugieriger Mensch. Der Durst nach Wissen ist etwas Positives und sehr Menschliches. Und wer will nicht wissen, wie die Welt zu dem wurde, was sie heute ist?
Man nimmt sich z.B. ein Geschichtsbuch vor und liest nach, was in früheren Zeiten passiert ist und wie die Welt früher war. Denn das, was wir heute um uns herum sehen und erleben, gibt uns wenig Aufschluss darüber. Aber wer schreibt solche Geschichtsbücher, und woher beziehen die AutorInnen ihr Wissen über Vergangenes? Darüber wurde schon oben Einiges gesagt, z. B. über Quellen (siehe oben, Teil 2.).
Die Menschen, die sich eingehend mit Geschichte beschäftigen und sie an einer Hochschule studieren, die ihr vertieftes Wissen in Büchern oder Aufsätzen weitergeben, diese nennt man Historiker bzw. Historikerinnen. Sie sammeln nicht nur vorhandenes Wissen Anderer, sie forschen auch selbst nach, um Antworten auf Fragen zu finden, die bisher nicht beantwortet wurden oder sich neu stellen.
Wer in den Artikeln und Büchern Anderer liest, dem kann auch einmal auffallen, dass es Ungenauigkeiten oder Unstimmigkeiten gibt und in dem einen Text etwas steht, das in einem anderen anders dargestellt wird. Mich z.B. fordert so etwas heraus, ich will es genau wissen und es nicht im Ungefähren lassen. Dazu ein Beispiel:
Im mittelalterlichen Köln gab es oft Auseinandersetzungen zwischen der Bürgerschaft bzw. dem Rat der Stadt auf der einen und dem Erzbischof als Stadtherren auf der anderen Seite, weil die Bürger mehr Mitsprache und Mitbestimmung forderten. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen gab es auch innerhalb der Stadt Streit zwischen Parteigängern des Erzbischofs und des Autonomiestrebens. Hier formierten sich die Overstolzen, dort die Weisen. Das eskalierte im Jahr 1268 zu bewaffneten Zusammenstößen der beiden Parteien: Erst überfielen die Weisen am 10.01. ein Bankett der Overstolzen, um deren Gast Wilhelm IV. von Jülich zu fangen, doch der konnte fliehen. Bürgermeister Ludwig Weise von der Mühlengasse wurde gefangen, entfloh aber bald darauf. Im Sommer desselben Jahres kam es zwischen den Parteiungen zu einer Straßenschlacht, in der Ludwig Weise erschlagen wurde. Die Weisen flohen aus der Stadt. Noch im selben Jahr, am 14./15.10., versuchten sie mit Verstärkung, von außen einzudringen und sich der Stadt zu bemächtigen. Das führte zur „Schlacht an der Ulrepforte“, in der auf beiden Seiten einige Kämpfer ihr Leben ließen. Dabei, meint ein Text, sei Ludwig Weise zu Tode gekommen.
Ja, was denn nun? Richtig ist, lapidar gesagt: Ludwig kam bei den Auseinandersetzungen 1268 ums Leben. Aber wann genau, und wie? Ich finde, man kann bei Zusammenfassung von Fakten auch leicht durch Verkürzung des Geschehens eine Verfälschung des Ablaufs erzeugen. Wer also eine Darstellung historischer Vorgänge schreibt, muss aufpassen, dass dabei die „historische Wahrheit“ nicht auf einen griffige Verkürzung zusammengeschnurrt wird, die sich leicht konsumieren lässt, aber den wahren Ablauf nicht korrekt wiedergibt. Damit müssen übrigens nicht nur HistorikerInnen zurecht kommen, das betrifft genauso JournalistInnen, die aktuelle Nachrichten in Worte gießen und dem Publikum eine Sachverhalt in gebotener Kürze richtig und zugleich verständlich darstellen wollen. Daher muss man in beiden Tätigkeiten mit der Sprache arbeiten und sich sowohl präzise als auch verständlich ausdrücken können.
Bei der Erwähnung der Schlacht an der Ulrepforte fällt auch der Name des Johann von Frechen, der ebenfalls sein Leben verlor. Ein Autor hat einmal gemutmaßt, dieser Johann sei ein Ritter aus in Frechen ansässigem Adel gewesen, der auf Seiten der Ratspartei fiel. Das haben Andere so übernommen. Doch der Haken an der Sache ist: Ein Rittergeschlecht „von Frechen“ ist in den Quellen nicht zu finden. Außerdem ist ein „von“ als Namensbestandteil erst in viel späterer Zeit als Adelsprädikat festgelegt worden. Im Jahr 1268, am Übergang vom Hoch- zum späten Mittelalter, war „von“ nur eine Herkunftsbezeichnung. Was den Johann von Frechen betrifft, so handelt es sich um einen Angehörigen der Bierbrauer-Zunft in Köln, er mag als junger Mann von Frechen nach Köln gekommen sein und zur Unterscheidung von vielen anderen Johanns (der Name war sehr beliebt) mit dem Zusatz „von Frechen“ benannt worden sein.
Diese Ungenauigkeit zum Zusatz „von“ ist ein Beispiel für allerlei Schwierigkeiten bei dem Bemühen, die Lebenswirklichkeit in lange vergangenen Zeiten richtig einzuschätzen. Das trifft besonders auf das Mittelalter zu. In dieser (beinahe willkürlich) abgesteckten Epoche von ca. 1000 Jahren änderte sich so Manches, aber Vieles ist uns erst einmal so fern und fremd, dass wir unseren Blick von heute von dem Bemühen lösen müssen, alles mit Heutigem zu vergleichen. Außerdem sollten wir Vorurteile abschütteln, die uns vorgaukeln, wir wüssten ja im Prinzip schon Bescheid. Es geht dabei nur zum Teil um materielle Überreste, die man wissenschaftlich untersuchen kann; mehr geht es um das Weltbild in den Köpfen und das Lebensgefühl der Menschen, das wir verstehen wollen.
Was macht also eine Historikerin oder ein Historiker? Sie oder er versucht, den Denk- und Gefühlswelten der Menschen vergangener Zeiten möglichst nahe zu kommen, um zu verstehen, wie sie „tickten“ und warum sie sich manchmal in einer Weise verhielten, die wir aus heutiger Sicht nicht nachvollziehen können. Das ist, neben der Zusammenstellung der Ereignisgeschichte, eine Herausforderung für die historische Forschung. Der Lohn der Mühe ist: Wir gewinnen dabei Kenntnisse und Erkenntnisse über menschliches Verhalten und seine Variationen unter bestimmten Lebensverhältnissen.
Über allem steht immer die Frage: Wie sah unsere Welt früher aus, und wie konnte sie zu der werden, die sie heute ist? Und wer will, kann daraufhin spekulieren, welche Möglichkeiten der Entwicklung es für die Zukunft gibt — doch das ist nicht mehr Aufgabe der HistorikerInnen.
.